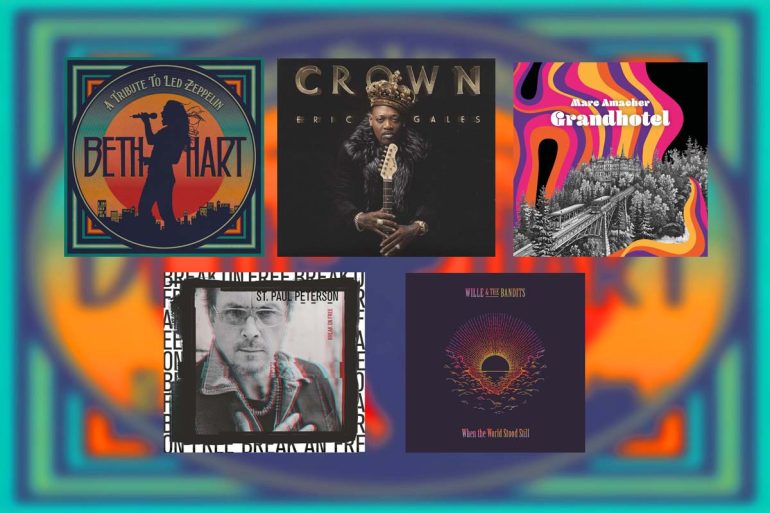Prof. P.’s Rhythm and Soul Revue – Frankly, my dear, I don’t give a damn
Der Professor meldet sich zurück mit Reha-Soulrockfunk von Wille & The Bandits, St. Paul Petersen, Eric Gales, Beth Hart und Marc Amacher.
Hab Euch vermisst, Freunde. Vielleicht habt Ihr es gemerkt, vergangene Ausgabe war der Professor nicht in da house. Mein Sumpfpony meinte mich auf glatten Wegen abwerfen zu müssen. Der Prof. rollte in den Graben und musste sich mühsam wieder aufrappeln. Nun sitze ich in fragwürdiger Haltung an der Maschine, um Euch ein neues Kapitel unserer never ending Rhythm and Soul Revue in die Tasten zu hämmern. Es geht weiter, immer weiter – auch wenn ich mir nach diesem Intermezzo nochmals eine kurze Zwangspause gönnen werden muss, um alle Knochen wieder dahin zimmern zu lassen, wo sie hingehören. Seid versichert: I’ll be back, um hier eines der 100 bedeutendsten Zitate aus amerikanischen Filmen anzuführen, auf Platz 37 übrigens der Liste des American Film Institute. Auf Platz eins, wen’s interessiert: “Frankly, my dear, I don’t give a damn” – die letzten Worte, die Rhett Butler in Vom Winde verweht an Scarlett O’Hara richtete. Nun denn, der Professor hat noch viele, viele Worte in der Pipeline, lasst Euch also von seinem kleinen Sabbatical nicht beunruhigen. Genug überhaupt davon. Jetzt sitzen wir gerade so schön zusammen, lasst mich Euch also ein bisschen von dieser und jener Platte erzählen, die die vergangenen Wochen den Weg zu mir fand. Anfangen will ich mit einem nostalgischen Gefühl der Wehmut, etwas, was auf diesen Seiten ja immer wieder mal aus dem Gebüsch springt. Vor einer halben Ewigkeit, kurz bevor wiederum das Virus aus der Hecke hüpfte, besuchte ich ein halbverwaistes Etablissement in einer Seitenstraße unweit des North German Mississippi. Vor kleinem Auditorium brachialblueste dort ein Trio aus dem schönen Cornwall, die anonymen Rosamunde-Pilcher-Enthusiasten unter Euch werden sofort allerromantischste Bilder vor Augen haben. Man sprang von links nach rechts und zurück, ließ die Beine zappeln und wiegte sich entrückt vom Hier-und-Jetzt zu psychedelischen Endlossoli, ach, allein die Erinnerung verschafft mir einen kleinen Orgasmus. Well, stay tuned.
PS: Zwei, drei von Euch grübeln noch, von wem das Zitat “I’ll be back” stammt? Nun, kleiner Tipp: In Teil 2 der Filmreihe sagt derselbe Terminator: “Hasta la vista, baby.”

Cornwall im Südwesten Englands scheint nicht die schlechteste Ecke der Welt zu sein, um die Pandemie auszusitzen. Der Atlantik bläst frisch übers grüne Land, das von drei Seiten von Wasser umgeben ist und sowohl den westlichsten (Land’s End) als auch den südlichsten Punkt (Lizard Point) Englands zu bieten hat. Das Klima ist mitunter mediterran bis verregnet, in Newquay trifft man sich zum Surfen, beobachtet von den Locationscouts von ARD und ZDF für den nächsten Wellnessfilm im deutschen Hauptabendprogramm. Irgendwo hier wohnen Wille Edwards und seine Bandits, und da man als „Großbritanniens beste Liveband“, wie manch Expertenforum für britischen Bluesrock durchaus zu Recht superlativiert, in vergangenen Jahren recht wenig zu tun hatte, komponierte man zum Glück auf der Couch herum, gruppenfinanzierte sich in Fankreisen ein nettes Spendensümmchen zusammen und buchte sich alsbald in den romantisch an den Ufern des Fowey Rivers gelegenen Sawmill Studios ein. Googelt das mal, folks, da will man gleich Musiker werden, nur um dort mal aufnehmen zu dürfen – wie übrigens auch schon Oasis, Robert Plant oder The Kooks. Wille & The Bandits nun schufen hier ein grandioses Studioalbum, ihr fünftes, banden alles an Soul, Blues, Stoner Rock, Psychedelic und sonstigen Swamp-Vibes, die offenbar in den Moor- und Heidelandschaften des Fowey Rivers herumwehen. Mittlerweile um eine Hammondorgel vom Trio zum Quartett gereift, präsentiert die Band ihr wohl vielseitigstes, reifstes Werk. Bombastrock, Bottleneck-Slide und Blueswumms verschmelzen zu einem ganz eigenen, in den Siebzigern verhafteten Soulrocksound. Hört mal hier rein: „Caught In The Middle“ (der Eröffnungssong morpht Psychedelic Soul und Hip-Hop zu einer schönen Boom-Ballade über gnadenloser Bassline) und „I’m Alive“ (pumpender James-Bond-Rock mit exotischer Gewürznote, very interesting, indeed).

Break one free – kann man so übersetzen: sich von etwas frei machen. Oder einfach „mal einen raushauen“. Bei St. Paul Petersons neuem Werk trifft’s eher Auslegung B. Denn der frühere Mitarbeiter von Prince hat mit Break One Free tatsächlich jenseits der Midlifecrisis – er ist knapp 60 – ein Album rausgehauen, liebe Leute … Funk aus fast vergessenen Tagen, fett und dennoch zeitlos frisch, Achtzigerjahre-Saxofonsoli inklusive. Samuraischwertscharfe Arrangements von Wah-Wah-Gitarren, Bläsergewittern und vollmundig quakender Hammond, angetrieben von Basslinien, die nicht von dieser Welt stammen. Freigemacht vom ehemaligen Entdecker, Mastermind und Boss hat sich hier also niemand, war sicher auch nicht geplant. Das Ganze klingt stark nach Prince, und das ist ja auch kein Wunder. Paul Joseph Peterson beendete gerade die Highschool, als Prince den damals 17-Jährigen als Vollzeitkeyboarder für seine Begleitband The Time verpflichte, als Ersatz für den geschassten Tastengott Monte Moir übrigens. Das war 1983, bereits ein Jahr später gelangte Peterson in den Reihen von The Time zu Weltruhm als Teil der Film-, Album- und Tourband zum Erfolgsprojekt Purple Rain. Kurz darauf wiederum baute Prince rund um den jungen Keyboader und talentierten Sänger die Band The Family auf. Der nun als St. Paul firmierende Musiker war damit der erste, der die Prince-Komposition „Nothing Compares 2 U“ singen durfte, bevor das Stück an Sinéad O’Connor ausgelagert wurde. Obwohl auf Break One Free einige für meinen Geschmack zu glatt produzierte R’n’B-Balladen zu finden sind, auch das war, sind wir ehrlich, ein Prince-Trademark, hauen mich doch einige Stücke dermaßen in die Seile, dass ich glücklich angezählt übers Parkett wanke. Titelsong „Break One Free“ mit Gastgitarrist Eric Gales beispielsweise wird Euch alle Synapsen neu programmieren, Freunde, und „Something In The Water“ ist genau der Minneapolis-Funk, den wir seit dem Tode von Prince so vermissen. A-one, A-two, you know what to do…
PS: Prince verstarb ja vor sechs Jahren – doch nun ist offenbar ein seltsames Filmdokument aus alten Tagen aufgetaucht. Redaktionsgeister raunten mir zu, dass hier bald mehr zu erfahren ist …

Aufmerksame Leser wissen, dass auf den Seiten unserer kleinen Rhythm and Soul Revue eins ins andere greift, Zufälle gehören nicht ins Repertoire der professoralen Texterstellung. Droppte ich eben noch bei der Beschau von Break One Free nebenbei den Namen Eric Gales, dann war das natürlich ein durchkalkulierter Move. Denn hier sind wir nun, schauen aufs neue Werk eben jenes seit ca. 30 Jahren als Wunderkind des Bluesrock gefeierten Gales. Bei seinem 17., 18. oder 19. Studioalbum, genau mag ich das nicht zu verifizieren, lässt sich der Gitarrenmeister von seinem Freund – und jahrelangen Wettbewerber in Sachen weltbester Bluesrock-Impresario – Joe Bonamassa produzieren. Crown wurde das Album benannt, und um es ganz klar zu machen, der Titelsong textlich noch etwas ausgearbeitet: „I Want My Crown“ heißt das Stück. Bonamassa, ebenfalls Mitglied im Club der ewigen Wunderkinder, steuert großzügig ein Gitarrensolo bei. Nun fahren wir aber den halbironischen Tonfall mal etwas zurück, denn das wird Crown nicht gerecht: Ein grandioses, sattes Album, das zwischen Soulfunk, Gospelgrunge und Bluesrock hin und her wabert wie eine Lavalampe auf einem atlantischen Fischkutter bei Windstärke zwölf. Beispielhaft möchte ich das Eröffnungsstück „Death Of Me“ durchdeklinieren, in dem Gates recht selbstkritisch über seine wilden Jahre reflektiert und sich überlegt, was er mit der Erfahrung von heute dem jungen Eric von einst gerne sagen wollte, der auch als Raw Dawg und Rap-Entertainer Lil E zu Ruhm in den Straßen von Memphis kam. Musikalisch ist das ein großes, stilumarmendes Werk, so wie gesamte Platte. Aus recht knackigen Funkversatzstücken schält sich bei „Death Of Me“ ein Soul, der kurz in Achtzigerjahre-Hardrock-Pop abzugleiten scheint, bevor das Stück sich neu findet als Funk-Rap im Stile Public Enemys und schließlich in einem fulminanten Gitarrensolo eruptiert. Serviervorschlag des Professors: Laut hören.

Bei allen Verwerfungen, die das Virus bei Kunst und Kultur zu verantworten hat: Dieses Album hätte es ohne Lockdown vermutlich nicht gegeben. Led Zeppelin könne man nur mit Wut im Bauch spielen, hat Beth Hart einmal gesagt, ihre Wut aber habe sie über viele Jahre durch zunächst Drogen, dann Therapie und vor allem viel sportliche Betätigung auf den Bühnen dieser Welt zu befrieden gewusst. Dann kam die Pandemie, die britische Rocksängerin, für besonders verschwitzte, hingebungsvolle Konzertdarbietungen bekannt, schmorte daheim in Los Angeles, Ohnmacht und Wut wuchsen. Schließlich rief sie Produzent Rob Cavallo an, bekannt auch durch seine Arbeit mit Linkin Park und Green Day. Er hatte Beth Hart seit Jahren mit einem Zeppelin-Projekt in den Ohren gelegen, nun hörte er: „Rob, jetzt machen wir’s.“ Und wie sie’s machten: Beth Hart wirft sich in die neun Songs der britischen Psychedelic-Hardrock-Legenden, als gäbe es kein Morgen. Mit ungefilterter Gefühlswucht röhrt, rockt und raunt sich die mittlerweile 50-Jährige durch Klassiker wie „Whole Lotta Love“ (vom zweiten Album Led Zeppelin II, erschienen 1969), „Stairway To Heaven“ (von Led Zeppelin IV, 1971) und dem ebenfalls unvermeidlichen „Kashmir“ (Physical Grafitti, 1975, mit einem der bekanntesten Gitarrenriffs der Musikgeschichte, aber wem erzähle ich das, Freunde). Garniert wird die Klassiker-Parade von Stücken wie dem funkigen „Crunge“ (Houses Of The Holy, 1973), mit dem Led Zeppelin einst den Hut vor James Brown zogen und mit ähnlichen Ausflügen in Gefilde rechts und links vom Rock-Highway zeigten, wie vielseitig sie doch waren. Beth Hart wiederum gelingt es, dank Wut im Bauch und wild schwingender Stimmbänder erstaunlich nah an Roberts Plants Stimmcharakter heranzukommen. Begleitet wird sie von einer Allstar-Band mit Gitarrist Tim Pierce (Bruce Springsteen, Tina Turner), Bassist Chris Chaney (Slash), Keyboarder Jamie Muhoberac (Bob Dylan, Iggy Pop) und Schlagzeuger Dorian Crozier (Celine Dion, Miley Cyrus, Joe Cocker). Wer meint, das könnte seelenlos sein, wenn Céline Dions und Tina Turners Auftragsmusiker zusammenkommen, dem sage ich: Frankly, my dear, I don’t give a damn. Hier würdigen Profis das Werk von Legenden, ohne Experimente, voll auf die Zwölf. Right on!
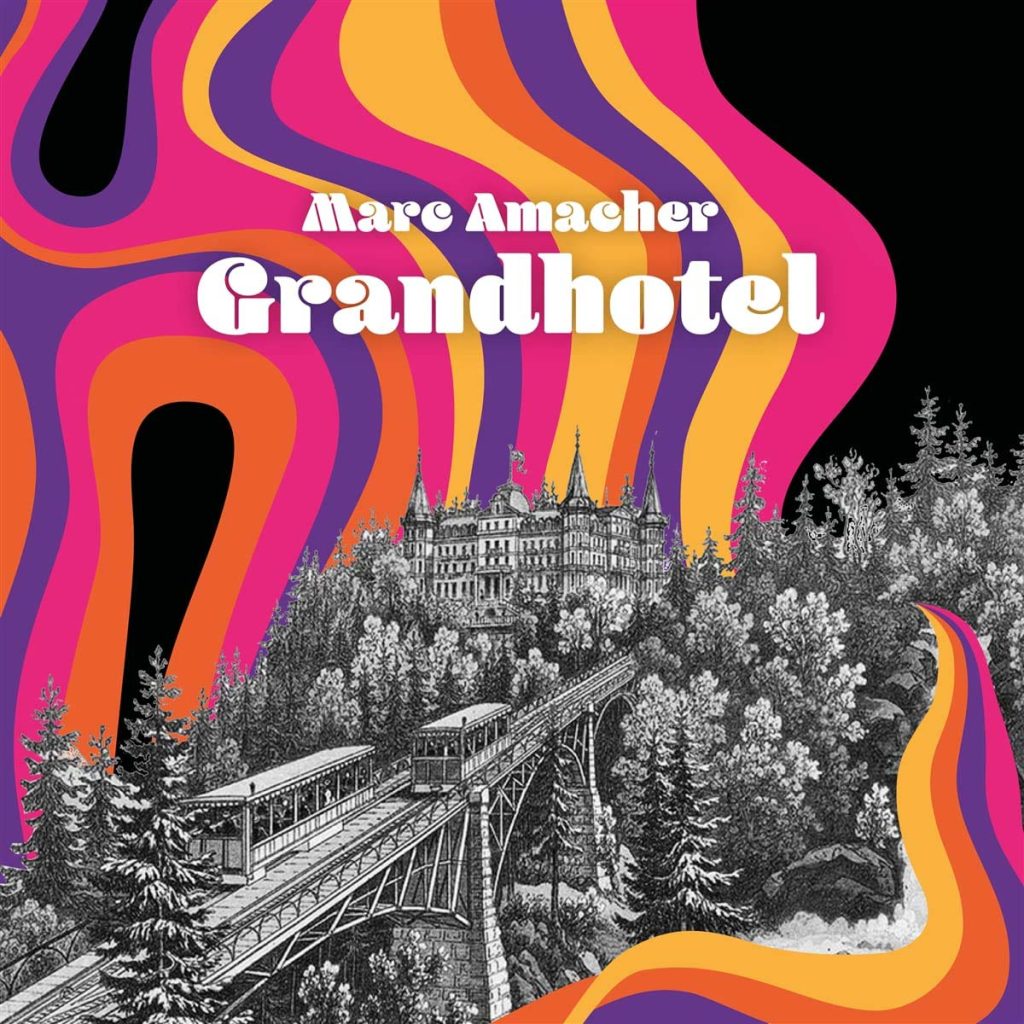
Das Grandhotel Giessbach in der Schweiz sieht auf den ersten Blick nicht so aus, als würde hier die Muse wohnen, zu deren Portfolio Stoner Rock, das Erbe von Motörhead und schleppender Mississippiblues gehörten. Das Viersternehotel liegt hoch überm Brienzersee, von Natur und Heidipanorama umgeben, ein wenig aus der Zeit gefallen. Immerhin, so liest man in der Hotelchronik, haben das 1875 gebaute Haus schon immer „Dichter und Musiker besungen“, während „gekrönte Häupter mit ihrem Gefolge“ hier „neue Kräfte schöpften“. Nun, diese veradelten Vibes scheinen auch den gelernten Straßenbauer Marc Amacher beflügelt zu haben. Mit seiner Band hatte sich der aus Funk und Fernsehen semibekannte Sänger-Gitarrist im Grandhotel Giessbach einquartiert, um unter der Sonne des Berner Oberlands zu sich und seiner Kunst zu finden. Das war wohl auch nötig, hatte ihm ein Ausflug ins Casting-TV 2016 zwar eine gewisse Prominenz verschafft, immerhin trug es ihn bei The Voice of Germany ins Finale, wo er schließlich einem gewissen Tay Schmedtmann unterlag, dessen Namen ich bis heute noch nie vernommen hatte. Hernach aber wollten seine Betreuer Michi und Smudo von den Mäßigtollen Vier den rockenden Bluesmann aus dem Kanton Bern in dies und das Korsett stecken, dessen Verschlusshaken er nun zum Glück vollends und in künstlerischer Eigenregie gesprengt hat. Sein zweites Album Grandhotel jedenfalls macht dem Professor viel Freude: Marc Amacher ist ein Gitarrist mit Gespür für Tempo, Raum und Gniedeldosierung. Er jodelt sich mit rauchig-soulvollem Organ durch gut geschriebene oder clever gecoverte Songs und kreiert so einen eigenen, von Blues, Stoner-Rock-Gerumpel und spartanischer AC/DC-Arithmetik geprägten Sound. Hört hier mal rein: „Stay Clean“ (von Motörhead entliehener Brachialblues, belebt von psychedelischem Stoner-Atem) und „STFU“ (wabernder Blues aus dem Hinterland des Mississippi, umweht von einer frischen Brise des Berner Oberlands).