Nina Attal – “Meine Gitarre ist mein Anker”
Sie kommt aus Paris, Heimat des Chansons. Zu Hause aber ist Nina Attal in der Welt des Blues und des Soul. Die 29-jährige Sängerin und Gitarristin gehört zu den spannendsten Musikerinnen Frankreichs – und das seit 15 Jahren. Im Interview erzählt sie, wie sie als Teenager die Clubs mit Songs von Robert Johnson eroberte, was sie mit Billie Eilish gemeinsam hat – und warum Johnny Cash Einfluss auf ihr neues Album Pieces Of Soul hatte.
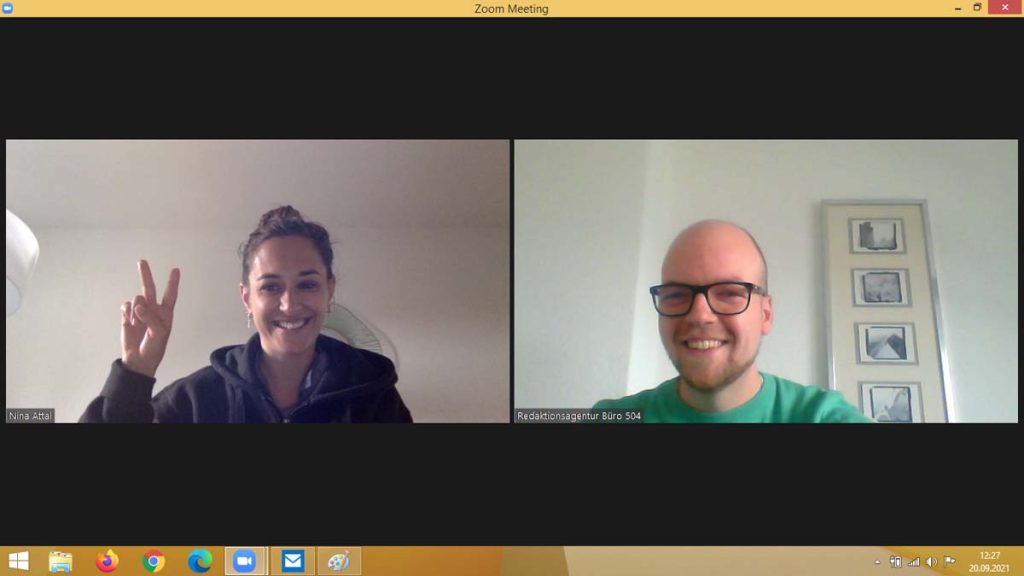
„Hi, Martin“, klingt es an einem Montagmorgen freudig aus den Boxen des Bildschirms. Ein kurzes Rauschen, da ist jetzt auch das Gesicht zur Stimme. Der Hintergrund aber wechselt – Nina Attal trägt ihren Laptop vor sich her. „Ich suche mir gerade eine ruhige Ecke“, erklärt sie FIDELITY-Mitarbeiter Martin Wittler. Dann steht das Videobild, Nina Attal sitzt auf einer Couch in ihrer Wohnung. „Allez!“, ruft sie freundlich – auf geht’s.
FIDELITY: Als Kind haben Sie B.B. King gehört – wie kam das denn? Ihre Eltern legten sich ja lieber Platten von David Bowie auf, wie Sie einmal erzählten.
Nina Attal: Rock fanden wir in der Familie eigentlich alle klasse. Den Blues aber hatte ich ganz für mich allein (lacht). Entdeckt habe ich ihn mit zwölf Jahren. Als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Als Teenager neigt man ja dazu, sich in Dinge hineinzusteigern. Bei mir war das die Bluesmusik, B.B. King und so, ich hab’ lange nichts anderes gehört. Dann erst kamen Bands wie Led Zeppelin und AC/DC dazu.
Wirklich? Sie spielen auch „Thunderstruck“?
Natürlich. Tatsächlich habe ich’s vor ein paar Tagen wieder gespielt. Auf meinem Youtube-Kanal spreche ich mit allen möglichen Musikern über die Ursprünge ihrer Musikleidenschaft. Dann spielen wir gemeinsam die Lieder, mit denen alles begann. AC/DC kommt da nicht selten vor.

Können Sie denn auch „Hells Bells“ singen?
Nun ja … AC/DC ist eine faszinierende Band. Da klingen Sänger und Gitarrist beide einzigartig. Als einzelner Künstler kann man das schwer in sich vereinen. Aber genau das will ich schaffen: dass Gitarre und Gesang zu einer Einheit werden.
Ihr neues Album entstand nach einer langen Reise entlang der Westküste der USA. Ist Pieces Of Soul quasi ein Urlaubssouvenir?
Auf keinen Fall! Das war ein wahnsinnig aufreibender Trip. Meine Beziehung war gerade in die Brüche gegangen. Ich hatte mich und auch meine Musik irgendwie verloren. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich war zwar mit meiner Mutter unterwegs, dennoch habe ich mich häufig sehr allein gefühlt. Die tollen Landschaften an der Westcoast habe ich kaum wahrgenommen. Aber irgendwann war ich wieder klar im Kopf. Und ich wusste: Ich will ein neues Album machen.

Den Mix der Gefühle kann man hören. Manche Songs klingen melancholisch. Andere wirken wütend und angriffslustig. „I Won’t Make It“ klingt fast wie die Metal-Hymne „Paranoid“ von Black Sabbath …
Heavy Metal ist Gitarrenmusik, eigentlich müsste ich also Metal-Fan sein. Bin ich aber nicht. Vielleicht liegt das am häufig eher schrägen Gesang (lacht). Black Sabbath ist dann wohl eher ein sehr unbewusster Einfluss. Aber klar: All die Eindrücke, die ich auf der Reise gesammelt habe, sind Teil des Albums. Es gab viele Bilder und Gedanken, die ich musikalisch verarbeitet habe.
Unterwegs haben Sie erste Song-Ideen mit dem Smartphone aufgenommen. Ist das die neue Zeit? Soul mit dem Telefon aufzunehmen?
Nein, das iPhone war für mich eher so eine Art Notizbuch. Ansonsten bin ich in Sachen Technik echt nicht die beste Ansprechpartnerin. Alles, was mit Laptops, Computern und Technik zu tun hat, macht mich völlig verrückt. Aber die Aufnahmefunktion am Telefon zu bedienen, das kriege ich gerade noch hin (lacht).

Auf Pieces Of Soul befindet sich auch ein Coversong aus den 60er Jahren: „You’re No Good“, mit dem Linda Ronstadt einen Nummer-eins-Hit hatte. Den Song haben schon unzählige Künstler interpretiert, von Sheryl Crow über Van Halen bis zu den Toten Hosen aus Deutschland. Was reizt Sie an diesem Lied?
Ich weiß noch ganz genau, wie und wo ich den Song zum ersten Mal gehört habe. Damals war ich noch ein Kind, und im Fernsehen lief eine Wiederholung von Johnny Cashs A Concert Behind Prison Walls aus dem Jahr 1974. Linda Ronstadt trägt diesen verdammt kurzen Rock und singt diesen großartigen Song. Und das vor lauter Gefangenen. Das hat mich damals umgehauen. Den Song hatte ich also schon lange auf meiner To-do-Liste. Meine Version sollte nach echter, grooviger Soulmusik klingen. Auf der Bühne funktioniert die Nummer auf jeden Fall super. Das Faszinierende an dem Lied ist: Eigentlich kennt es jeder. Nur weiß niemand so wirklich, woher.
Im Video zum selbstkomponierten „Daughter“ wirft ein kleines Mädchen seine Gitarre ins Meer. Sollen das Sie sein?
Ja und nein. Das Mädchen bekommt die Gitarre ja wieder, von mir als Erwachsener. Das ist ganz persönlich: Meine Gitarre ist mein Anker. Egal wie schlecht es mir geht oder wie turbulent die Zeiten sind: Meine Gitarre wird mir immer bleiben. Ich wollte schon vieles in meinem Leben mal aufgeben. Aber nie die Musik.

Mit 15 Jahren standen Sie das erste Mal auf der Bühne eines Blues-Clubs in Paris. Hatten Sie nicht mit Klischees zu kämpfen? Als junge Frau, klein von Statur, die den Blues spielen will?
Ich wusste immer, dass ich mich wahrscheinlich mehr beweisen muss als die anderen. Für Dinge, die mir wichtig waren, musste ich härter einstehen. Das hat mir geholfen, meinen Platz zu finden und auch zu verteidigen. Heute bin ich in der Szene akzeptiert. Hoffe ich. Im Blues-Club damals, im Utopia, habe ich mich musikalisch das erste Mal zu Hause gefühlt. Ich war früher sehr schüchtern und konnte meine Leidenschaft für Bluesmusik nie mit Menschen teilen. Wer hört schon mit zwölf Jahren B.B. King oder Robert Johnson? Dort war das anders. Die Menschen haben die gleiche Musik geliebt wie ich. Ich wusste: Hier bin ich richtig.
Sie wurden dann bald als kommender französischer Weltstar gefeiert. Das erinnert ein wenig an den Trubel rund um Billie Eilish, die mit 17 zum Weltstar wurde. Mit „Good Guy“ haben Sie nun quasi das Pendant zu Eilishs Welthit „Bad Guy“ im Repertoire. Zufall?
Totaler Zufall. „Good Guy“ kam auch vor „Bad Guy“ heraus. Wenn, dann müssten Sie die Frage also ihr stellen. Ich finde Billie Eilish toll. Ihre Musik ist einzigartig. Wer ein Lied von ihr hört, erkennt sie sofort. Das ist etwas, wonach letztlich alle Künstler streben. Ich auch.

Ihr Album Wha! wurde 2014 von Chic-Bassist Jerry Barnes produziert und in den Avatar Studios aufgenommen, wo bereits Paul McCartney und Stevie Wonder Songs einspielten. Spürten Sie die alten Sound-Vibes?
Als ich das Studio in New York betrat, wusste ich gar nicht, wie mir geschah. Auf einmal stand da zum Beispiel Dennis Chambers vor mir. Der Mann hat vorher schon für Santana oder Maceo Parker Schlagzeug gespielt. Und dann steht der da vor einem, macht sich ganz entspannt einen Kaffee, isst Thai Food und begrüßt mich lässig. Alle waren total nett zu mir. Die fanden es einfach toll, denke ich, dass da jemand Junges kam, der ihre Musik gut fand und sie in die Neuzeit überführen wollte. Nichts nervt mich mehr als Menschen, die sagen: Warum willst du junge Französin jetzt unsere gute alte Musik spielen? Die Konsequenz daraus wäre ja, dass die Musik irgendwann ausstirbt.
Diesmal haben Sie in der Normandie in den Black Pool Studios aufgenommen. War diese nordfranzösische Aura wichtig, rauer Wind und kreischende Möwen?
Als ich Maxime Lebidois, den Produzenten der neuen Platte, kennengelernt habe, wusste ich gar nicht, wo sein Studio liegt. Als ich dann dort ankam, dachte ich nur: Was für ein verdammt genialer Zufall. Das Studio liegt nämlich direkt am Strand. Einen Schritt vor die Tür, und ich konnte sofort den Sand an den Füßen spüren. Das war für mich die perfekte Verbindung zu meiner Reise durch die USA. Und damit zu den Liedern: Die Momente, in denen ich die Songs geschrieben habe, hatte ich sofort wieder vor Augen.

Hätte das Album also anders geklungen, wenn Sie es in der Provence aufgenommen hätten?
Das kann schon sein. Dort gibt es zwar auch schöne Strände, aber die Landschaft ist doch lieblicher. Klar, es beeinflusst mich, wo ich meine Songs aufnehme – welche Landschaften mich umgeben, was ich letztlich anschaue, wenn ich am Album arbeite.
Mit französischen Sängerinnen verbindet man schnell Chanson. Ist es als Künstler*in eigentlich schwer, sich von diesem Erbe zu befreien?
Ach, ich bin gerne anders als die anderen. Chanson gehört definitiv zu Frankreich, zu unserer Kultur. Vielleicht aber auch nur deshalb, weil wir Franzosen einfach so schlecht in Englisch sind und daher eine eigene Blues-Spielart brauchten.

Sie singen ohne französischen Einschlag, sprechen aber schon mit deutlichem Akzent. Wie geht das denn?
Das war nicht leicht. Ich habe viel an mir gearbeitet. Ich wollte ernst genommen werden. Als junge Frau mit starkem französischem Akzent wäre das schwierig geworden im Blues. Deshalb, ganz ehrlich: Das bedeutet mir echt viel, wenn Sie das sagen! Ich schätze, ein Vorteil ist auch, dass ich immer schon englische Musik höre. Das gesungene Englisch, das habe ich vermutlich einfach im Ohr.


