Eine kleine Geschichte der Stereofonie
Es fing viel früher als erinnert an. Als 1958 die ersten Stereo-Schallplatten in die Läden kamen, war die Idee der mehrkanaligen Wiedergabe von Schallereignissen, die Stereofonie, nämlich bereits fast 80 Jahre alt …
Schon 1881 ließ der Flugpionier und Erfinder Clément Ader bei der Internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris eine Opernaufführung auf mehreren Kanälen in entfernte Räume übertragen. Noch nicht erfunden waren freilich Medien, auf denen man diese Übertragung für die Nachwelt hätte festhalten können. Die musikalischen „Stars“ des ausgehenden 19. Jahrhunderts in Surroundsound hören zu können wäre heute eine Sensation auch außerhalb der High-End-Gemeinde. Wichtig: Schon diese sehr frühen Versuche, Schall so zu reproduzieren, wie der Mensch ihn „im richtigen Leben“ wahrnimmt, konnten nur mit der Wandlung der Schallwellen in elektrische Signale vernünftig funktionieren. Dem rein akustisch arbeitenden Phonographen des Erfinders Thomas Alva Edison hätte man die Mehrkanaligkeit schon aus physikalischen Prinzipgründen nicht anerziehen können, er blieb monofon.
Und es ward stereofon
Die ersten echten Stereoaufnahmen folgten in den 1930er Jahren unter anderem unter Federführung des EMI-Elektroingenieurs Alan Dower Blumlein, der mit seinem „binauralen“ Verfahren am 19. Januar 1934 eine Probe von Wolfgang Amadé Mozarts Sinfonie Nr. 41 „Jupiter“ (KV 551) mitschnitt. Es spielte das London Philharmonic Orchestra unter Sir Thomas Beecham. Schon 1931 hatte sich Blumlein die sogenannte Zwei-Komponenten-Schrift für die Stereoplatte patentieren lassen, eine Kombination aus Edisons Tiefenschriftverfahren von 1877 mit senkrechter Auslenkung der Graviernadel und Emil Berliners Seitenschriftverfahren von 1887 mit waagerechter Bewegung der Graviernadel. Die Kombination beider Schriften führte zum heute noch verwendeten Stereoschriftverfahren der Langspielplatte (LP). In etwa zeitgleich arbeiteten A.C. Keller und I.S. Rafuse bei den US-amerikanischen Bell Laboratories an Stereo-Aufnahmetechniken und hielten 1931/32 den legendären Dirigenten Leopold Stokowski und das von ihm geleitete Philadelphia Orchestra stereofon für die Nachwelt fest.

Vielleicht die spannendsten Versuche in jenen Steinzeittagen der Stereofonie unternahm die Reichsrundfunkgesellschaft (RRG) in Berlin. Ermöglicht wurden diese durch die Weiterentwicklung des sogenannten Magnetophons zum Tonbandgerät heutiger Prägung sowie durch Eduard Schüllers Zwillingskopf, der ursprünglich für die Aufteilung des Frequenzbereiches auf zwei Spuren konstruiert wurde, um die Dynamik der Bandaufzeichnung zu verbessern – das heftige Grundrauschen der Tonträger aus den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg kennt jeder, der sich mit historischen Musikaufnahmen beschäftigt. Beim Reichsrundfunk wurde der Schüller-Zwillingskopf allerdings für Versuche mit der nagelneuen Stereofonie genutzt. Wie auch in anderen technologischen Bereichen wollte Nazideutschland hier die Nase vorn haben und investierte nicht unbeträchtliche Summen in die zweikanalige Aufzeichnung von Schallereignissen.
Jene, die sich mit dem neuen Aufnahmeverfahren beschäftigten, während draußen die stetig vorrückenden alliierten Truppen der deutschen Hauptstadt immer näher kamen, waren echte Pioniere: Bereits ab Januar 1943 nahmen die Toningenieure Helmut Krüger und Dr. Ludwig Heck Musik in Stereo für Archivzwecke auf. In Zeiten, in denen es nicht einmal versuchs- oder ansatzweise einen privat erhältlichen Tonträger gegeben hätte, auf den man die Stereo-Tonbänder hätte überspielen können.
Die Flak musizierte mit
Heute sind von jenen Aufnahmen des Reichsrundfunks nur noch klägliche Überbleibsel vorhanden. Auf CD umgeschnitten finden sich beispielsweise ein Mozart-Klavierkonzert mit dem stilbildenden Pianisten Walter Gieseking und der Finalsatz von Anton Bruckners Achter Sinfonie, die im September 1944 mit der Staatskapelle unter Herbert von Karajan im Sendesaal 1 an der Berliner Masurenallee von der Reichsrundfunkgesellschaft in Stereo aufgezeichnet wurde, während die ersten drei Sätze aus den Aufnahmesitzungen Juni/Juli 1944 nur in Mono vorliegen. Wer genau hinhört, wird in leisen Passagen das hämmernde Feuern der Flugabwehrgeschütze erlauschen – als diese Aufnahme entstand, war der Kampf der Nazis gegen die aus allen Richtungen die Hauptstadt Berlin angreifenden Alliierten in vollem Gang.
Der Krieg hat auch Schuld daran, dass von der Stereopracht jener Jahre – die Rede ist in zeitgenössischen Quellen von etwa 250 Stereoaufnahmen, darunter die Opern Romeo und Julia von Hector Berlioz, Margarete („Faust“) von Charles Gounod, Tosca von Giacomo Puccini sowie Richard Wagners Tannhäuser und die Meistersinger, aufgenommen in Bayreuth 1943 unter Hermann Abendroth und 1944 unter Wilhelm Furtwängler – praktisch nichts blieb.
Als die russische Armee Berlin einnahm, besetzte der russische Oberst Popow, selbst ausgebildeter Rundfunkmann, am 2. Mai 1945 das Funkhaus mit 200 Soldaten, ohne auf Widerstand zu stoßen. Popow hatte von 1931 bis 1933 im Berliner Funkhaus als Techniker gearbeitet und es im Mai 1941, nicht allzu lang vor dem deutschen Einmarsch in Russland, als Mitglied einer sowjetischen Delegation besichtigt. Nach den heute vorliegenden Informationen nahmen die sowjetischen Truppen das Tonbandarchiv des Reichsrundfunks einschließlich der Stereobänder, deren Wert dem Militär damals wohl kaum bewusst gewesen sein dürfte, mit nach Russland, wo sich die Spur der Aufnahmen verliert. Versuche, Russland in der Nachkriegszeit zur Herausgabe der Bänder zu bewegen, blieben erfolglos.
In den USA spürte man von den Kriegsereignissen naturgemäß weniger. 1940 kam der aufwendige, bis heute Maßstäbe setzende Walt-Disney-Animationsfilm Fantasia in „Fantasound“, einem frühen stereofonischen Tonverfahren, heraus. Kaum ein Kino jener Jahre war allerdings technisch in der Lage, die Stereospur von Fantasia wiederzugeben. Wie sauber man bei Disney arbeitete, lässt sich freilich an den mittlerweile erhältlichen Blu-ray-Umschnitten dieses legendären Zeichentrickstreifens nachhören.
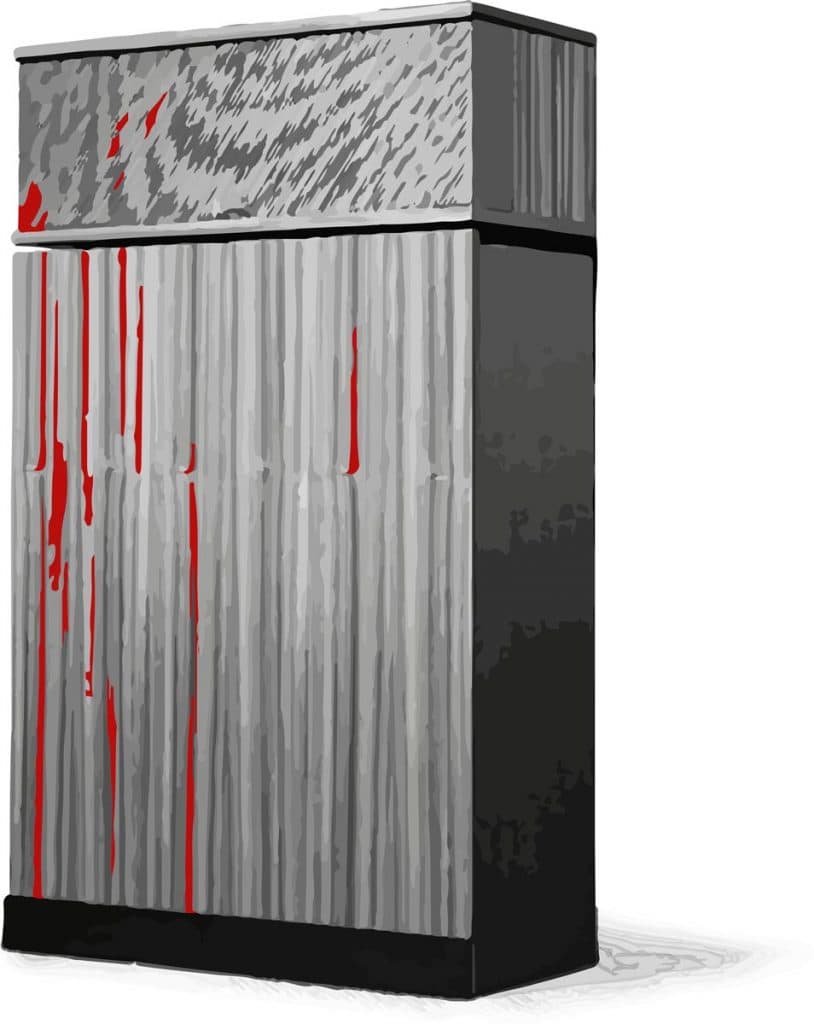
Während in Westdeutschland 1945 das große Aufräumen anfing, arbeitete man in den USA und auch in England daran, Stereofonie für das Publikum massenkompatibel und zugänglich zu machen. Als 1957 die ersten Zweikanal-Schallplatten erschienen, nahmen die großen Plattenlabels ihre Produktionen vor allem auf dem Klassiksektor längst stereofon auf. Wer in den frühen 1950er Jahren Stereo hören wollte und gut betucht war, kaufte sich ein Stereo-Tonbandgerät nebst passendem Zweikanal-Verstärker und die entsprechenden Bänder dazu. Auch sie waren ziemlich teuer und für Otto Normalverbraucher nahezu unerschwinglich, was an die Markteinführung der CD gut drei Jahrzehnte später erinnert.
Sidney Frey, Chef des Plattenlabels Audio Fidelity Records, brachte 1957 die erste Stereo-Schallplatte heraus: Auf der einen Seite waren diverse Eisenbahngeräusche zu hören, auf der anderen Seite Oldtime-Jazz mit der Band Dukes of Dixieland.
Stereofone Schallplatten wurden billiger, als in der Bundesrepublik und den meisten anderen westlichen Ländern die Fertigung von Schellackplatten im Juli 1958 aufgegeben wurde. In der Deutschen Demokratischen Republik vollzog sich die gleiche Umstellung erst 1961. Die aufkommende LP aus strapazierfähigem Polyvinylchlorid (PVC) ließ sich nicht nur wesentlich einfacher in Massen fertigen, sie erlaubte auch die Herstellung stereofoner Tonträger in großen Stückzahlen. Zudem ermöglichte Vinyl deutlich schmalere Rillen (sogenannte Mikroschrift) als Schellack. Jener ist übrigens eine harzige Substanz, die aus den Ausscheidungen der Lackschildlaus – sie ernährt sich von Pflanzensaft – gewonnen wurde. Der Schellack fungierte bei der Plattenfertigung als Bindemittel für die Füllstoffe (u. a. Ruß und Schiefermehl). Auch wenn sich bis heute Schellackplatten erhalten haben, muss doch klar sein, dass es mit der Langzeit-Haltbarkeit der organischen Substanz nicht allzu gut bestellt ist. Man sollte Schellackplatten auch keinesfalls mit modernen Plattenwaschmaschinen säubern, denn die dabei verwendeten Reinigungsflüssigkeiten könnten die Scheiben im wahrsten Wortsinn aufweichen und zerstören.

Spielen wir ein wenig Pingpong
All jene, die heute alte Schallplatten sammeln, sollten sich bewusst sein, dass die Entzerrung nach RIAA („RIAA-Kurve“) erst Mitte der 1950er Jahre standardisiert wurde. Die Zahl der Phonoverstärker, die noch verschiedene Entzerrungskurven beherrschen oder von Hand einstellbar sind, ist im Jahr 2020 klein und fast ausschließlich auf das sehr hochpreisige Sortiment beschränkt. Darüber hinaus sollte man monofon in die Rillen gepresste Musik auch mit einem passenden Mono-Tonabnehmer abtasten, weil ein Stereo-Tonabnehmersystem stets nur einen Kompromiss darstellen kann und nie die ganze Klangpracht aus der Mono-Rille fördern kann.
Als aus Unterhaltungs- und Tanzmusik das Weltphänomen Pop wurde – woran der Rock’n’Roller Bill Haley mit seiner fetzigen Musik für das Film-Schuldrama Blackboard Jungle (in Deutschland Saat der Gewalt, 1955) nicht ganz unschuldig war –, musste auch die Stereofonie „Mutationen“ über sich ergehen lassen, die mit High Fidelity beziehungsweise High End wenig bis nichts zu tun hatten.
Am auffälligsten unter diesen „Sound-Sünden“ war fraglos das „Pingpong-Stereo“, wie es sich auf diversen Scheiben der englischen Kultgruppe The Beatles findet: Die Instrumente und/oder Gesangsstimmen wandern von einem Lautsprecher zum anderen. Es gibt auch die Variante, dass die Instrumente auf einen Kanal, der Gesang auf den anderen Kanal gelegt wurde. Hauptsache, aus jedem Lautsprecher kam etwas anderes.
Überhaupt ist es auffällig, wie weit die Schere der Klangphilosophien auseinanderging und wie sehr auch der Ausreifungsgrad beziehungsweise die Aufnahmequalität sich unterschieden: Während im Pop und oft auch im Jazz wenig Wert auf Natürlichkeit der Wiedergabe gelegt wurde und sogar die Stereofonie selbst noch bis tief in die Sechziger hinein durch Abwesenheit „glänzte“, entstanden zeitgleich jene Großtaten der Klassikproduktion, die bei der amerikanischen RCA „Living Stereo“ genannt wurden und bei der Konkurrenz Mercury Records „Living Presence“. Die Radio Corporation of America, heute im Besitz von Sony Music, sprang schon 1950 auf den Vinyl-Schallplattenzug auf und veröffentlichte, noch in Mono, Aufnahmen, nach denen Sammler und Musikliebhaber sich heute gleichermaßen die Finger lecken, darunter die Gaîté Parisienne von Jacques Offenbach, eingespielt von Arthur Fiedler und dem Boston Pops Orchestra.
Ab 1958 gehörte die RCA zu den ersten Plattenfirmen weltweit, die Stereoaufnahmen anboten. Zu den Künstlern der ersten kommerziellen Stereo-Jahre zählte wieder Leopold Stokowski, der Zugstücke wie George Enescus Rumänische Rhapsodie in Stereo einspielte. Dazu kamen nach und nach die Namen, die heute noch jeder Plattensammler kennt, zumal dann, wenn er nach Stoff für die High-End-Anlage lechzt: Fritz Reiner, Pierre Monteux oder Charles Munch. Ikonen der Tonträger-Geschichte, deren Einspielungen auch aus anspruchsvoller Perspektive 70 Jahre später immer noch ausgezeichnet klingen.

Exkurs: In der kurzen SACD-Ära der frühen 2000er Jahre fand eine ganze Reihe Aufnahmen aus der Blüte der „Living Stereo“-Epoche den Weg auf die hochauflösende Silberscheibe. Als Sony die SACD überstürzt aus dem Programm nahm, weil sie entgegen der Erwartungen des Riesenkonzerns nicht einmal ansatzweise den Erfolg der zu diesem Zeitpunkt etwas über 15 Jahre alten CD erreichte, blieben die Living-Stereo-Wiederauflagen ein Torso mit Umschnitten, die trotz hohen Aufwandes zum Teil nicht die Klangqualität der Vinyl-Vorlagen erreichten. Inzwischen haben kleine Labels die Rechte an den ikonischen RCA-Aufnahmen erworben und bringen SACD-Umschnitte auf den Markt, welche die Originale aus der Schallplattenära manchmal sogar toppen. Und auch wiederaufgelegte LPs buhlen um die Gunst der Käufer. Besonders interessant erscheinen die SACD-Versionen der Living-Stereo- und Living-Presence-Aufnahmen, weil ein Teil von ihnen seinerzeit in einer Dreikanal-Technik aufgenommen worden war, die später zeitweilig wieder verworfen wurde. Auf diesen SACDs kann man also, entsprechende Verstärkertechnik vorausgesetzt, manche Klassikproduktion erstmals so hören, wie sie einst auf das Tonband kam.
Stereo wird zur Normalität
Die Nachkriegsjahre, vor allem die „wilden Sechziger“, waren von dem Bemühen geprägt, Stereofonie endlich auch für Normalverdiener erschwinglich zu machen. Der Schreiber dieser Zeilen besaß eine von den Eltern geerbte „Musiktruhe“ – im Prinzip war das ein Röhrenradio mit eingebautem Plattenspieler und Stereoverstärker, an das man externe Lautsprecher anschließen konnte, um in vergleichsweise ordentlicher Qualität Stereo zu hören.
Die echten Klangkulinariker waren in der Nachkriegszeit selbstredend längst weiter und profitierten von einer Unterhaltungselektronik-Industrie, für die Stereofonie einen der wichtigsten Konjunkturmotoren darstellte. Das Trichter-Grammophon wurde vom tragbaren oder stationären Plattenspieler abgelöst, Gutbetuchte leisteten sich in jenen Jahren beispielsweise einen der ungemein gut klingenden Plattendreher der englischen Firma Garrard, deren Modell 301 jenem Trend den Weg ebnete, der erst Jahre später die Bezeichnung „High End“ bekommen sollte.
Verstärkt wurden die Signale, die der heute sehr teuer gehandelte Plattenspieler mit seinem Reibrad-Antrieb lieferte, damals noch von Röhrengeräten, die auf demselben Prinzip gründeten wie die Musiktruhe meiner Eltern. Sogar eine DIN-Buchse besaß dieses Mitte, Ende der 1950er Jahre gebaute Gerät, an die es die Stereosignale in Hochpegelform weiterleitete. Hier wurde dann zunächst eine Bandmaschine, später ein sogenanntes Kassettendeck angeschlossen.
Die Idee, Tonbänder in ein handliches Kunststoffgehäuse einzuspulen und so dem selbst bei Tonbandprofis nicht immer vermeidbaren Bandsalat der großen, sperrigen Bandmaschinen ein Schnippchen zu schlagen, war so bestechend und dennoch simpel, dass aus der „Compact Cassette“ (CC) oder „MusiCassette“ (MC) ab ihrer Vorstellung durch die holländische Firma Philips 1963 nach anfänglichen Formatstreitigkeiten der Tonträger der nächsten 25 Jahre werden sollte. Was auch damit zu tun hatte, dass die von vornherein handlich gestalteten Kassetten-Abspiel- und Aufnahmegeräte immer kompakter wurden.
Im Jahr des Drachen
Gipfelpunkt der Miniaturisierung war Sonys Walkman, nicht viel größer als die Kassette selbst und ausgestattet mit einer Klangqualität, die zumindest bei den späten Modellgenerationen fraglos auch höhere Ansprüche erfüllte. König der stationären Kassetten-Stereogeräte war unzweifelhaft der „Dragon“ der japanischen Schmiede Nakamichi, der sogar die seinerzeit schwer angesagte Autoreverse, also das automatische Umdrehen der Kassette beherrschte. Die RX-Modelle der Japaner setzten dem die Krone auf: Bei denen wurde nicht die Laufrichtung des Tonband-„Schnürsenkels“ umgekehrt, wie dies zahllose mit klanglich suboptimalen Vierspur-Köpfen ausgerüstete Kassetten-Autoradios praktizierten, sondern die Kassette selbst in Windeseile automatisch umgedreht. Damit gelangen fast unterbrechungslose Aufnahmen oder wahlweise die mehrstündige Dauerberieselung mit Musik, denn die maximale Aufnahmedauer einer Kompaktkassette lag (mit gefährlich dünnem Bandmaterial) bei beeindruckenden 180 Minuten, 90 Minuten pro Seite.

Versuche, in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren die analogen Tonträger „aufzubohren“, führten zu kommerziell erfolglos bleibenden Experimenten wie der Quadrofonie. Auch ein Vierkanal-Plattenspieler in Form einer superkompakten All-in-one-Anlage fand in den Siebzigern den Weg in den familieneigenen Bestand. Das bei der fränkischen Weltfirma gebaute, elegant in Pultform gestaltete Gerät namens „Studio 2040 HiFi“ klang allerdings vergleichsweise mäßig, und vor allem das Angebot an quadrofonen Schallplatten hielt sich in äußerst engen Grenzen. Die Zeit war vor knapp 50 Jahren ganz offensichtlich noch nicht reif für Mehrkanal-Sound. Und das, obwohl mit der „CD-4/Quadradisc“-Technologie von RCA und der japanischen JVC Victor Company ein überaus aufwendiges Aufnahmeverfahren samt zugehörigem Tonträger entwickelt worden war, das den Markt von Grund auf hätte umkrempeln können.
Dem auch Jahrzehnte nach Ende der Schellack-Ära unvermeidlich scheinenden Rauschen der Tonträger beziehungsweise der Aufnahmesysteme rückte der amerikanische Ingenieur Ray Dolby in seinen Dolby Laboratories, Inc. mit speziellen elektronischen Unterdrückungssystemen zu Leibe. Auf das eher mäßig effiziente Dolby A folgten schnell die Versionen B und C und kurz vor Schluss der Kassetten-Epoche noch das in intelligenter Weise abwärtskompatible Dolby S, das ahnen ließ, welches Klangpotenzial zumindest theoretisch in der Kompaktkassette stecken konnte. Parallel arbeitete man in den Dolby Laboratories, Inc. ebenfalls an mehrkanaligen Verfahren, mit denen man die Stereofonie ablösen wollte.
Eins und Null betreten die Bühne
Den analogen Tonträgern bereitete gleichwohl erst der Siegeszug der Digitaltechnik ein vorläufiges Ende, das deutlich schneller als ursprünglich angenommen kommen sollte. Nachdem schon in den 1970er Jahren im Umfeld besagter Quadrofonie mehrkanalfähige digitale Aufnahmegeräte entwickelt worden waren, die sich aufgrund des einfachen Umgangs mit ihnen und der geringen Störanfälligkeit schnell auch im Profibereich festsetzten (wenngleich manche Toningenieure zum Teil bis heute auf analoge Aufnahmetechnik schwören), entwickelten Philips/PolyGram und Sony Ende der 1970er Jahre gemeinsam die Compact Disc, kurz „CD“, die sich schnell zum beherrschenden Tonträger des Musikmarktes entwickeln sollte. Eine CD ist eine „Silberscheibe“ aus Polycarbonat von zwölf Zentimetern Durchmesser, beschichtet mit einer reflektierenden Schicht aus Aluminium oder edleren Materialien, auf die nach den Standardvorgaben 74 Minuten Musik oder 650 MB Daten passen.

Das Volumen des Speicherplatzes geht nach einer schönen (aber mehr als fragwürdigen) Legende auf den Dirigenten Herbert von Karajan zurück, der die Möglichkeiten des neuen Tonträgers sofort richtig einschätzte und seine Aufnahme von Ludwig van Beethovens Neunter Sinfonie, die bei Karajan 73 Minuten und ein paar Sekunden dauerte, auf einer Einzel-CD untergebracht wissen wollte – der Medienprofi Karajan hatte messerscharf erkannt, dass das neue Medium nicht zu kostspielig und auch nicht zu komplex werden durfte, wenn es Erfolg haben sollte.
Bei etwas „liberalerer“ Auslegung des sogenannten Redbook-Standards für die CD-Produktion sind heutzutage sogar 84 Minuten Spieldauer möglich. Die CD wird per Laserstrahl berührungslos abgetastet, Nullen und Einsen werden ausgegeben, wenn der Laser in der Spur einen Übergang von einer Vertiefung („pit“) zu einem Abschnitt ohne Vertiefung („land)“ passiert oder umgekehrt. Ein einprogrammierter Fehlerkorrektur-Algorithmus sorgt dafür, dass Kratzer und andere Schäden der Oberfläche im Gegensatz zur LP zumindest in der Theorie keine Kratzgeräusche oder Aussetzer produzieren. In der Praxis erwies sich die CD allerdings als deutlich empfindlicher gegen mechanische Einwirkungen als erhofft. Zwar lassen sich auch ramponierte Exemplare bis zu einem gewissen Beschädigungsgrad noch ohne hörbare Aussetzer abspielen, eine häufig zum Eingreifen gezwungene Fehlerkorrektur verschlechtert aber hörbar den Klang.
Die CD kam 1983 auf den Markt, ab Ende 1984 wurden die Abspielgeräte erschwinglich. Weihnachten 1985 hielt im Hause Draminski mit dem Philips CD 150 der erste CD-Player Einzug. Für 450 Mark in der Vorweihnachts-Rabattaktion eines längst nicht mehr existierenden Nürnberger Innenstadt-Radiogeschäfts gab es eine Maschine im Midi-Format, deren Plastikgehäuse und dezent rappelige Schubladenmechanik darüber hinwegtäuschten, dass die klangrelevanten Innereien vom Feinsten waren. Zwar arbeitete besagter CD 150 „nur“ mit 14-Bit-Wandlern, die 1984/85 schlicht Stand der Technik waren, aber als Zulieferer werkelte ein Laufwerk mit Schwingarm-Laser auf einer Metallgussbasis, dessen Langlebigkeit und Abtastsicherheit von späteren Kunststoff-Konstruktionen nie wieder erreicht wurde.
Der neue Tonträger, anfangs noch als exotisch belächelt und angesichts selbstbewusster Preise – Whitney Houstons Debütalbum kostete auf CD im Jahr 1985 ganze 39 Mark, während es die LP-Fassung für 20 Mark gab – auch keine Aufforderung zu exzessivem Kaufverhalten, trat innerhalb weniger Jahre einen beispiellosenFSiegeszug an. Heute spricht mancher Manager der Musikbranche im Zusammenhang mit der Boomphase der CD von „Goldgräber-Jahren“. Die CD wurde rasch bezahlbarer, das Repertoire erweiterte sich rasant und die Plattenfirmen erkannten rasch, dass sich auch mit dem „Backkatalog“, also der Wiederveröffentlichung ursprünglich auf LP veröffentlichter Alben, gutes Geld verdienen ließ. Dies führte zu streckenweise bizarren Auswüchsen: So dauerte es beispielsweise Jahre, bis die Platten der Beatles wiederveröffentlicht wurden – und dann brachte die britische EMI als Rechteinhaberin zunächst Monoversionen selbst von den Alben heraus, die es in der Epoche der Schallplatte bereits in Stereoversionen gegeben hatte. Erboste Beatles-Fans reagierten auf diese Veröffentlichungspolitik verständlicherweise wütend – und mit etwas Zeitverzögerung gab es dann endlich auch zentrale Werke wie Revolver oder Help! in originalem Stereo.

Der Übergang von Analog zu Digital ist nicht nur mit Blick auf solche ärgerlichen Vermarktungsstrategien als holperig zu bezeichnen. Es dauerte auch eine Weile, bis man die Einschränkungen und Probleme des Mediums CD in den Griff bekam. An dieser Stelle soll der alte Streit „Digital gegen Analog“ nicht neu befeuert werden. Beide Musikwiedergabeverfahren können ausgezeichnet klingen, frühe CDs und die dazu passenden Abspielgeräte sind aber noch weit entfernt vom Optimum, wenn man sie mit ihren aktuellen Gegenstücken vergleicht.
In den Anfangsjahren glich die CD einer Anleitung zum Gelddrucken, denn die Rechteinhaber diverser zentraler Aufnahmen der Stereo-Epoche konnten bei minimalen Mehrkosten ihre Archive erneut und oftmals mehrfach vermarkten. Nervös wurden manche Manager erst, als auch Normalverbraucher Zugriff auf preiswerte Digitalgeräte mit Aufnahmefunktion bekamen. Nach der Vorstellung des Digital Audio Tape (DAT), gefolgt von ein- oder mehrfach beschreibbaren CDs, die mit den bisherigen Abspielgeräten mehr oder weniger kompatibel waren und jeweils verlustfreie 1:1-Kopien von CDs ermöglichten, konterte man flugs mit einem Kopierschutz, der maximal eine digitale Kopie vom Original erlaubte und die „Kopie von der Kopie“ durch Setzen eines speziellen Prüfbits im digitalen Signalstrom verhinderte.
Im Gegenzug fanden sich clevere Elektroniktüftler, die den Kopierschutz durch Modifikation der digitalen Aufnahmegeräte aushebelten. Zudem gab es DAT- und CD-Recorder für den Profibereich, bei denen der Kopierschutz auf Knopfdruck genullt wurde. Aus dem lange und leidenschaftlich geführten Kampf zwischen den Soft- und Hardware-Produzenten entstand immerhin die Entwicklung der schon erwähnten Super Audio CD (SACD) durch die CD-Systemerfinder Philips und Sony. Der mit hochaufgelöst gespeicherter Musik gefüllte Tonträger hatte den aus Sicht der Musikkonzerne unschätzbaren Vorteil, dass seine Digitalspur nicht kopiert werden konnte. Die ersten SACDs waren auch nicht abwärtskompatibel, es musste also für den Eintritt in die Welt des „High Resolution Audio“ ein neues Abspielgerät angeschafft werden, das technisch auf der schon bekannten Video-DVD basierte. Erst eine Weile später, als die Verkäufe der Ende 1999 vorgestellten SACD weit hinter den Erwartungen zurückblieben, entschieden sich Sony und Co., „Hybrid SACDs“ zu produzieren, die auch über eine herkömmliche CD-Schicht verfügen, also quasi „Doppeldecker“ sind – unterschiedliche Laser-Wellenlängen machen es möglich.
Die SACD ist heute ein Nischenprodukt, das zumindest von kleinen Musiklabels weiter gepflegt wird. Auch 2020 gibt es, allerdings nicht mehr von den „Major Labels“ wie der Bertelsmann Music Group oder Universal, regelmäßig neue SACD-Veröffentlichungen und auch neue SACD-Player.

Medium ade
Die Zukunft der aufgezeichneten Musik ist gleichwohl nichtphysisch: Im selben Maß, in dem die digitalen Netze besser ausgebaut werden und die möglichen Datenraten steigen, verlieren auch die Tonträger, die fast ein Jahrhundert das Medium der Musikfreunde waren, rapide an Bedeutung. Musik kommt aus dem Internet, Musikportale mit verschiedenen Bezahlmodellen ersetzen das Stöbern in Plattenläden und den CD-Kauf. Die CD wird zum Medium für unabhängige Musikproduzenten, die den einschlägigen Netzportalen wie Tidal, Spotify oder Amazon Music (um nur ein paar von vielen Beispielen für Netzanbieter von Musik zu nennen) keine Provision zahlen können oder wollen. LPs und die zugehörige „Hardware“ wie Plattenspieler und Phonoverstärker erleben seit einigen Jahren eine Renaissance, ihre Verkäufe sind auf relativ niedrigem Niveau stabil, es gibt viele Neuproduktionen auch wieder im analogen Format. Im Gegenzug werden Mehrkanaligkeit ebenso wie hochaufgelöste und deshalb exzellent klingende Aufnahmen zu einem leicht zugänglichen Gut. Nur die Faszination, einen Tonträger auch haptisch zu „erleben“, kann die Musik aus dem Netz oder von der Festplatte nicht bieten. Aber jene, die damit nicht aufgewachsen sind, werden kaum einen Mangel empfinden – und stattdessen die Vorteile genießen.


