Das fünfte Element
Musik ist mir wichtig. Mehr als das. Nichts geht ohne und mit geht alles viel besser. Die Frage, was Musik zu so einem mächtigen Element macht und welchen Daseinszweck sie hat, beschäftigt mich seit langem. Eine Antwort habe ich noch nicht gefunden, aber als Hobby-Existenzialistin kann ich mit der Sinnlosigkeit im Allgemeinen und der Sinnlosigkeit der schönen Dinge im Besonderen bestens leben
Heute ist Dienstag, über Norditalien hängen schwere und dichte Nebelschwaden, die sich synchron gleich auch noch über mein Gemüt legen, und außerdem ist Januar ja sowieso ein völlig überflüssiger Monat. Mit dieser erfrischend positiven Einstellung habe ich mich heute Morgen an meinem Computer niedergelassen. Der erste Handgriff wie gewohnt: der Play-Button auf der Webseite von BBC Radio 6. Nach dem ersten Schluck Kaffee und den ersten Musik-News wird es mir dann auch schon wärmer ums nebelige Herz. Heute ist nämlich nicht nur Dienstag, sondern auch David Bowies 66. Geburtstag. Und dieser beschert uns zu diesem Anlass eine Überraschungssingle als Appetitanreger für sein im März erscheinendes Album The Next Day – dem ersten Studioalbum seit 2003. Die Single heißt „Where Are We Now“ und entführt uns nach Berlin und mich persönlich genau dorthin, wo ich mich an diesem Januarmorgen launisch befinden möchte. Das Stück untermalt meine latent unleichte Stimmung und stellt sie so auf ein genusswürdiges Fundament.
Musik zur Stimmungsintensivierung
Und das ist auch einer der Gründe, weshalb Musik bei mir den Stellenwert als fünftes Element einnimmt. Ich bin seit jeher und aus Überzeugung ein gemütstechnischer Sinuskurvenreiter. Ich mag Auf und Abs. Ein flacher Launenverlauf kommt einer Nulllinie gleich, und so verwende ich Musik gerne als stimmungsintensivierendes Mittel. Das fing schon in den frühen 80ern mit Prokofjews Musikmärchen Peter und der Wolf und Rolf Zuckowskis Vogelhochzeit an. Letztere versuchte ich dann auch noch relativ eigenwillig anhand einer Blockflöte selbst zu interpretieren.
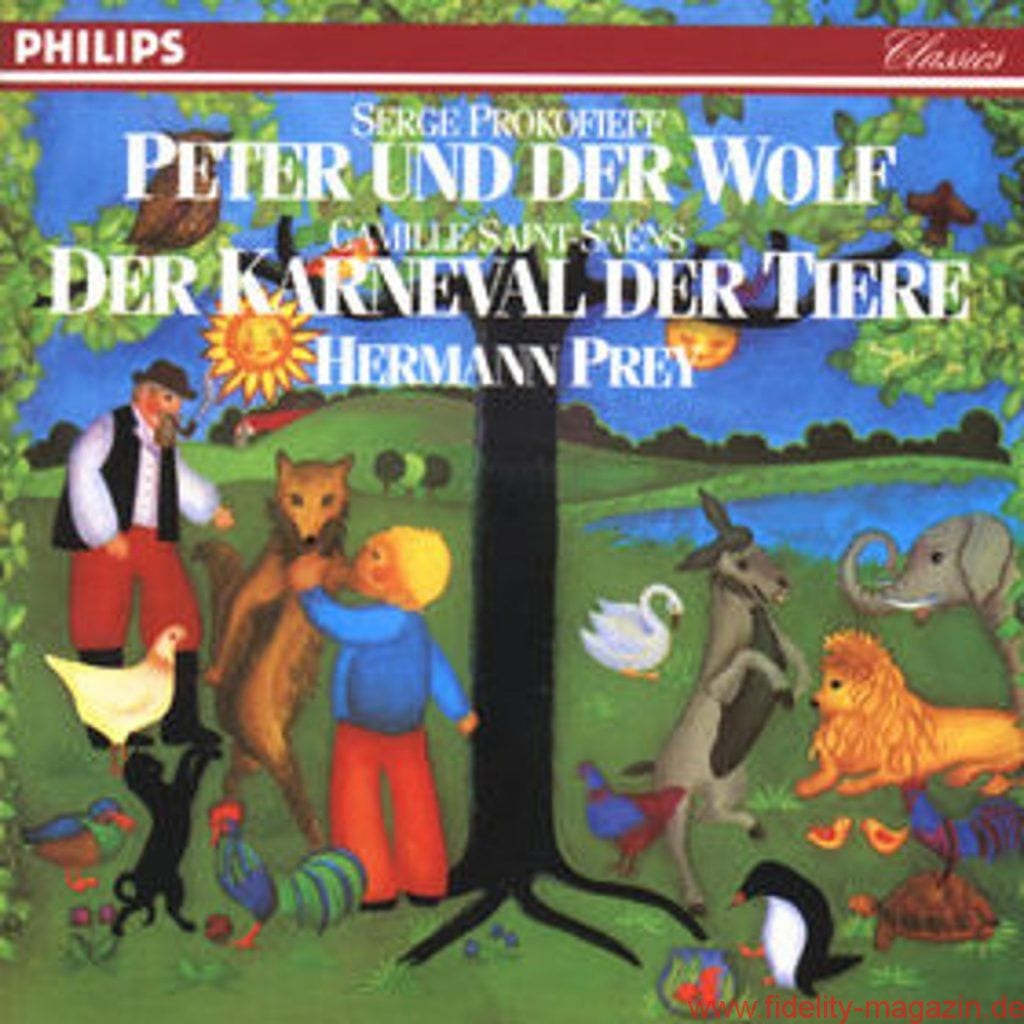
Camille Saint-Saens – Der Karneval der Tiere
Hermann Prey
CD/Philips Classics
Kindermusical und Flötenwerkzeug sollten mich aber nur kurzzeitig befriedigen, und so kam ich häufiger, als den Eltern lieb, mit Anmeldungen zu Instrumentenkursen aus der Schule nach Hause. Akkordeon und Klavier waren dabei noch die harmloseren Lautmacher. Als später Geige und E-Gitarre hinzukamen, wurde es Mutter und Vater angst und bange. Der Schlagzeugplan wurde dann erfolgreich vereitelt. Leider. Schlagzeugmädchen finde ich cool – Kate Schellenbach (Beastie Boys, Luscious Jackson) zum Beispiel oder Moe Tucker (Velvet Underground). Das mag sich so anhören, als wäre ich außerordentlich musikalisch, dem ist aber nur äußerst bedingt so, denn mein Talent ist relativ unausgeprägt und ich verstehe mich als reinen musikalischen Verbraucher. Ganz gleich, ob hinter dem Klavier oder vor den Boxen. Ich verleibe mir die Werke anderer Komponisten lieber ein, anstatt selbst kreativ zu werden. An den meisten Instrumenten tue ich dies eher recht als schlecht – so spiele ich Klavier stur vom Blatt und die Geige lieber gar nicht. Die Stereoanlage bediene ich allerdings weitaus virtuoser.
Beethoven zur Seelenreinigung
Musikkonsum gehört für mich zum guten Ton, und Leute, die behaupten, sie können gänzlich ohne auskommen, sind mir suspekt. Ganze Tage habe ich schon beim munteren Musikaustausch in den Wohnzimmern meiner Freunde zugebracht. Bei Herzschmerz verordnen wir keine Aphorismen, sondern Songs wie „The Rat“ von The Walkmen. Vor der großen Präsentation atme ich nicht einmal tief durch, sondern stecke mir die In-Ears ins Ohr und lasse mir von einer Uptempo-Nummer vorgaukeln, ich sei eine Powerfrau. Wenn ich mal unbedingt ganz weibisch und kathartisch heulen möchte, höre ich mir „Seasons in the Sun“ (Terry Jacks) an, den idealen Tränenkatalysator. Im Frühling greife ich regelmäßig ganz geistlos zum Abbey Road-Album der Beatles, um der Sonne mit „Here Comes The Sun“ zu huldigen.

CD/Deutsche Grammophon
Wenn ich mein hochtouriges Ich kultiviert bremsen und zur inneren Ordnung zurückkehren möchte, lege ich Beethovens Violinkonzert auf. Am liebsten interpretiert von Anne-Sophie Mutter. Und dann hefte ich mich an die Fersen der wahnwitzig hübschen Melodie und mache mir jeden einzelnen in- und auswendig verinnerlichten Ton bewusst. So lotse ich mich in einen Zustand, den ich ansonsten nur schwer und sicherlich nicht durch Yoga erreiche. Nichts lässt mich den Verlauf der Zeit deutlicher spüren als das penible innerliche Partiturlesen. Grundsätzlich entsteht im ersten Satz ca. bei Minute sechs aufgrund der melodiösen Erhabenheit ein dicker Klos in meiner Kehle, der sich dann etwa zwölf Minuten später, wenn die Melodie schließlich beim thematischen Höhepunkt landet, in Müdigkeit und Leere auflöst. Im dritten Satz dann füllt das neue muntere Thema, das etwas weidmännisch anmutet, den entleerten Gefühlskanister mit einer locker-luftigen Entspannung auf. Und so wird mein übervoller Geist im Laufe des Konzerts erst müde und schwer, verweilt im zweiten, etwas faden Satz in einer phlegmatischen Indolenz und erreicht gegen Ende den erfrischenden Neutralzustand einer Geläuterten. Egal, wie oft ich auf dieses musikalische Instrument der Seelenreinigung zurückgreife, ich kann mich stets auf den Effekt verlassen.
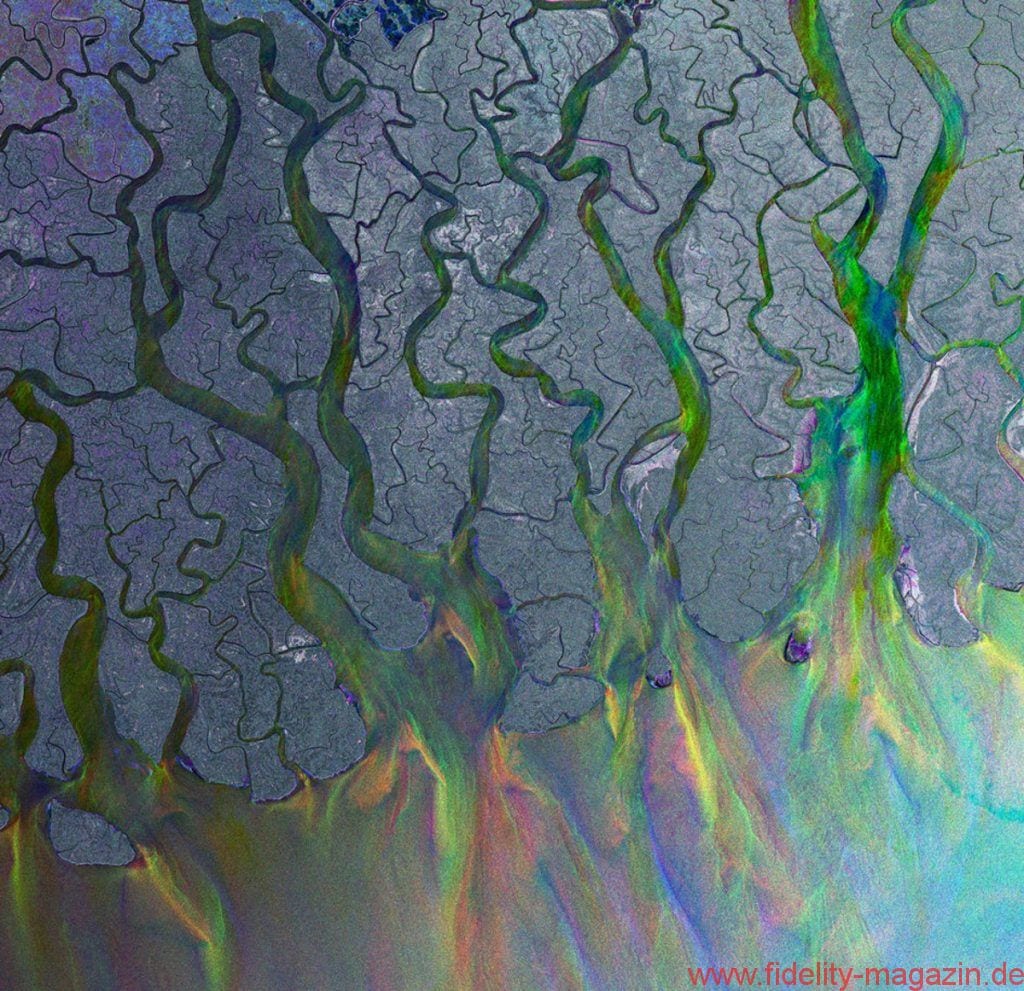
CD/Atlantic
Essenzieller Mehrwert
Aber ich gerate hier von einer Anekdote in die nächste, ohne einen roten Faden zu finden. Mir fällt es sichtlich schwer, in Worte zu fassen, was mir Musik bedeutet. Sie ist für mich kein Extra und auch nicht das Zentrum oder die Achse. Mein Leben dreht sich nicht um Musik, sie ist vielmehr ein essenzieller Bestandteil und Mehrwertschaffer. So zum Beispiel auch die Erkundung eines neuen Albums – ich liebe den Moment, wenn man über diesen einen Song stolpert, der ein Bullseye mitten im Herzen landet. Und das Beste daran: Dieser Moment kann jeden Tag geschehen, einfach so unverhofft und nebenbei. Kürzlich beispielsweise geriet mir das Album An Awesome Wave von Alt-J (Δ) in die Finger. Als die ersten Töne von „Fitzpleasure“ ertönten, passierte eben das, was passiert, wenn man über einen dieser ganz besonderen Songs stolpert. Der Puls erhöht sich, man wartet gebannt auf den nächsten Takt, den Verlauf der Melodie, und wenn der letzte Ton erklingt, weiß man, dass man einen Schatz gehoben hat, der einen lange Zeit nähren und unzählige Erinnerungen prägen wird. Oder nehmen wir die EP Halfbluud des gleichnamigen Projekts von Harley Prechtel-Cortez, einem der talentiertesten Allrounder, den ich in der virtuellen Welt bisher aufgetan habe. Die sechs Tracks, die man sich auf Bandcamp anhören kann (http://halfbluud.bandcamp.com) ergeben einen sanften Soundtrack ohne Film. Aber es lohnt sich auch, den Künstler dahinter unter die Lupe zu nehmen. Ich persönlich mochte bereits die Töne der kalifornischen Indie-Band The Weather Underground, die sich – angeführt von jenem Prechtel-Cortez – später als Red Cortez ähnlich schöne Tracks wie „All The Difference“ oder „Fell On The Floor“ hervorbrachten. Heute ist Prechtel-Cortez nicht nur solo unterwegs, sondern disziplinübergreifend auch als Filmemacher und Maler. Mir ist es schier unbegreiflich, wie viel Talent einem einzigen Homo sapiens – oder vielmehr Homo artisticus – innewohnen kann.
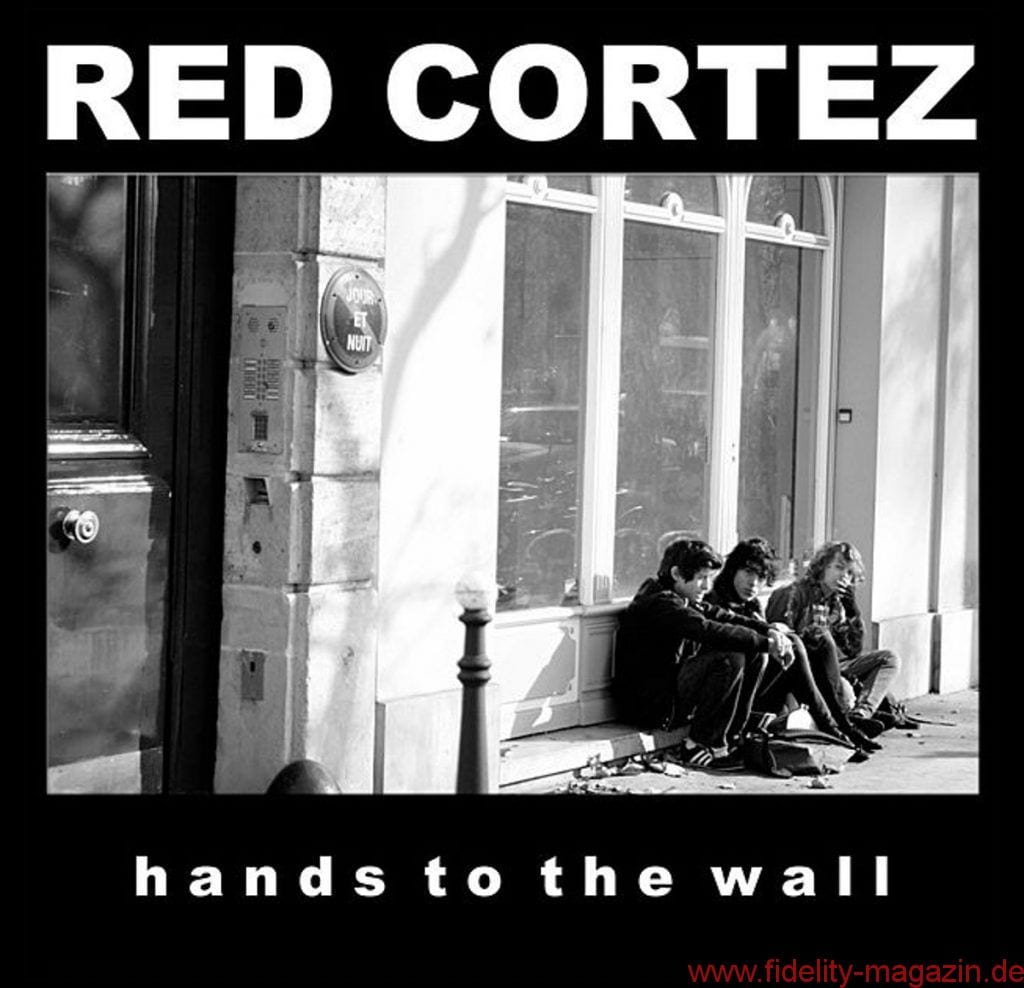
CD/East End
Und hiermit sei auch der Beweis angetreten, dass Musik weit mehr kann, als einen akustisch zu berieseln. Musik ist eine durchweg menschliche und emotionale Geschichte. Hinter Musik stecken Menschen, hinter diesen Menschen stecken Geschichten. Mithilfe von Musik verankern wir Erinnerungen und holen diese später wieder hervor. Musik vertieft Gefühlsregungen und verleiht ihnen gleichzeitig ein Ventil. In Kombination mit Texten wird sie zu einer schlagkräftigen Kommunikationsform. Musik macht das Leben lebendiger, bunter, lauter, spannender, intensiver, schöner, besser und agiert somit als natürliche Steigerung vielerlei Adjektive, Attribute und Stimmungen.
Auf ein Tänzchen
Abrunden mochte ich meinen Artikel heute mit dem Auszug aus einer kleinen privaten Abhandlung zum Thema „Gemüt & Musik“.
Das Gemüt ist ein wankelmütiger Gesell mit einem unbeschriebenen Gesicht. Es ist das Gewand, das ihm seine Form verleiht. Und Gewänder hat es viele. Erscheint es heute als leibhaftiges Bild des Verderbten im schwarzen Rock, springt es morgen unvermittelt als blasierter Faxenmacher um die Ecke und bittet um ein Tänzchen. Welches davon uns aber auch befällt, eines bleibt immer gleich: sein drakonischer Griff, sein erbarmungsloser Atem, den es uns in den wehrlosen Nacken bläst, und die Intensität seiner Gesellschaft. Wehren können wir uns mit aller Macht, doch führen wird dies ins Nirgendwo. Ich empfehle hingegen, die Aufforderung zum Tanz anzunehmen, eine adäquate Platte aufzulegen und sich auf dem Parkett mit dem Gemüt zu verbrüdern.


