Prof. P.’s Rhythm and Soul Revue – Funkidelity
VERDAMMT GUT, FLAMINGOS!
Der Professor verordnet zwecks Seelenentlüftung Soul und Funk zu inhalieren, und zwar von: The Kokomo Kings, Various Artists („Muscle Shoals“-Compilation), Lee Fields, Band of Rascals, John Butler, Bonerama, Gecko Turner, Rad Orchestra.
Es ist wieder so weit, Freunde, da der Professor seinen rechten Fuß in einem Eimer Lindenblütentee badet und den linken in einer Schüssel von heißem Ingwerwasser. Der Sud des stirnumschlingenden Magerquarkwickels nässt ihm die Augenbrauen, und irgendwo im internen Tora-Bora-Nebenhöhlenlabyrinth muss ein Schild hängen mit der Aufschrift „Sorry, we’re closed“. Aber wisset, Schäfelein des Souls, der Professor wird sich nie, nimmer & nullkommanull von einem lächerlichen Firus dafon abhalten lassen, dem Folke den Vunk zu bringen, so wahr ich Provessor P. heiße, auch dann nicht, wenn wegen eines vor 5,5 Sekunden erlittenen brachialen Hustenanfalls ganz kurz eine rare Orthografieschwäche hinsichtlich des korrekten Gebrauchs einiger Konsonanten durchs Oberstübchen gewehet war. Aber genug davon, wir wollen dem FIDELITY-Schwesterblatt, der Apotheken-Rundschau, nicht die Themen klauen. So will ich aber dennoch nicht verleugnen, dass ich in den vergangenen Tagen viel Zeit am Kamin bzw. am small man’s fireplace, dem Zentralheizkörper, verbrachte und dies und das künstlerische Werk zur Begutachtung heranzog. Dies im Übrigen schon aus purem Selbsterhaltungstrieb, denn parallel übte der Nachwuchs bis zur Besinnungslosigkeit Blockflöte, „O Tannenbaum“, während draußen das Jahr mit großen Schritten gen Frühling schritt. O, welch feine Musik aber schwoll aus des Professors Kopfhörern. Soul aus New York, Swamprock aus Kanada, Rockabilly aus Dänemark, some very strange tunes, so strange that I’m out of home grown words, also strange tunes deep from the heart of Hinterhoftischlerei, dazu Deep Fried Funk aus Alabama, und, und, und … Ach, die Vorfreude des Verkündens schwillt in professoraler Brust, lasst uns nun denn beginnen. Einmal noch ausschnauben, Hatschi, und nochmal: Hadschi Halef Omar Ben Hadschi Abul Abbas Ibn Hadschi Dawuhd al Gossarah (verzeiht diesen sinnentleerten Einwurf).
The Kokomo Kings – Too Good To Stay Away From

Too Good To Stay Away From
Label: Rhythm Bomb Records
Format: CD, LP
Es war einer dieser Abende, an dem ich durch Niesel, Nebel und Nachtschwärze taumelte, auf der Suche nach Erleuchtung und Erbauung in fragwürdigen Zeiten, ein Abend, an dem ich spontan an einer Tür klopfte, man mir ein kaltes Bier in die Hand drückte und mich vor die Bühne schob, auf der ein skandinavisches Gewitter tobte von solch elektrisierender Gewalt, dass mir die Kniescheiben weich wurden und ich mir zwei, drei Tropfen Brauerzeugnis auf den Latz kleckerte, doch wer will sich davon ablenken lassen, wenn die Menge tobt und die Band die Welle erwischt, Freunde, da heißt es dann go with the flow, denn die Kokomo Kings, nun wollen wir mal konkret werden in diesem schönen Endlossatzgefüge, eine Formation dänischer und schwedischer Musiker, lieferten eine so hirnvorderlappenversengende Show ab, mit magmaheißem Rock-and-Roll, brodelndem Sumpfstaatenblues, tobenden Rockabillygitarren und stetig groovendem Western Swing, Leute, Leute, das sollte man erlebt haben, und wer’s nicht erlebt hat, darf sich am Studiowerk der Kokomo Kings erfreuen, denn jene beiden Alben darf ich Euch dringendst an die rechte und linke Herzklappe tackern, und wer ein wenig Hintergrundinformation wünscht, soll wissen, dass Werk Nummer eins, Artificial Natural, bereits 2013 bei Grime Tone erschienen ist, und Nummer zwei, Too Good To Stay Away From, vor nun auch schon einem guten Jahr, aber ein Eintrag auf der Facebookseite der Band lässt vermuten, dass bald Nummer drei das Licht der skandinavischen Sonne erblicken wird, skål, sag’ ich da. PS: Sänger und Gitarrist Martin Abrahamsson sieht zwar aus wie ein stellvertretender Sparkassen-Filialleiter aus Schleswig, spielt aber wie der Teufel.
Various Artists – Muscle Shoals. Small Town Big Sound
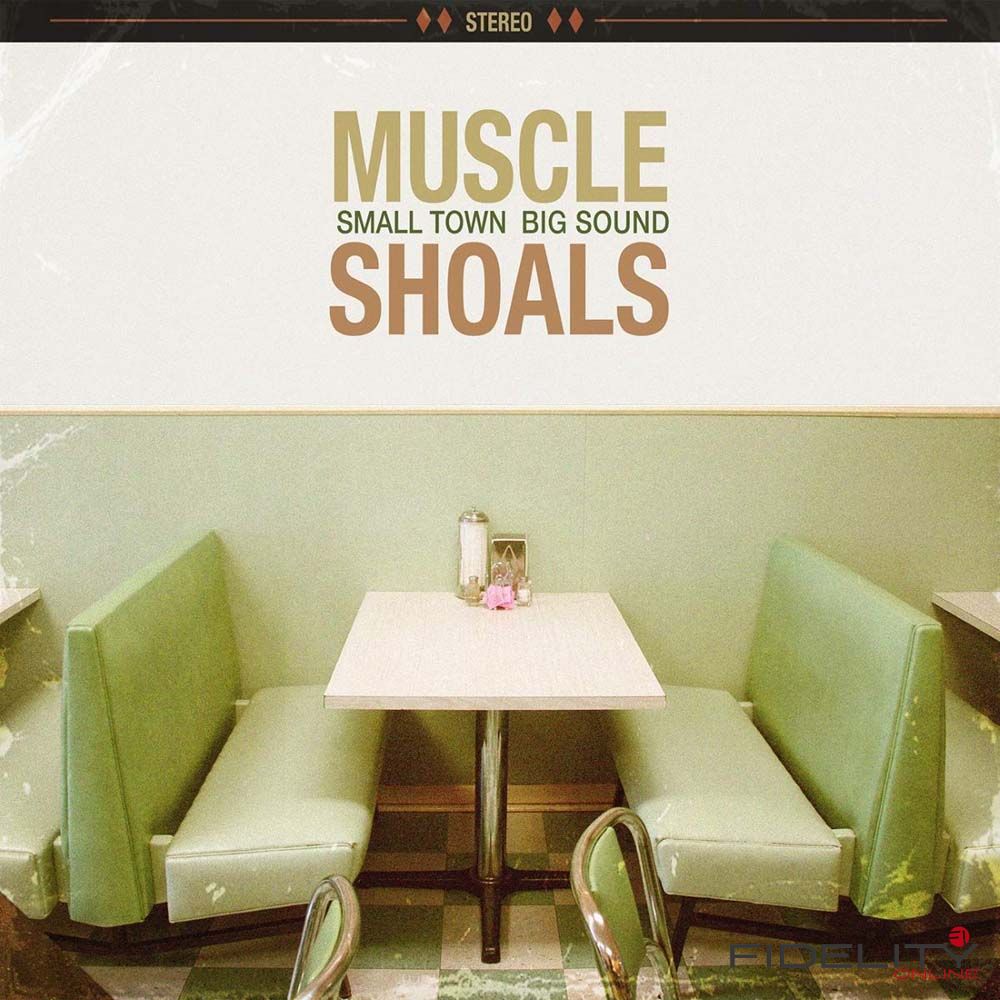
Muscle Shoals. Small Town Big Sound
Label: Muscle Shoals Music Group/BMG
Format: CD, LP, DL 24/48
Ab und an muss der Professor dem Alltagswahn in seiner familiären Shotgunbude entfliehen. Dann nistet er sich für ein paar Stunden beim Rambler ein, good ol’ Soulbrother, der Vinyl drehen lässt und weltgrößter Experte in Sachen Musikdokumentationen ist. Neulich wieder auf der alten Rambler-Couch gesessen und Muscle Shoals geschaut. 2013 beim Sundance-Festival Premiere gefeiert, danach fast vergessen. What a shame! Wahnwitzig-brillante Geschichte zweier Soulstudios im Südstaatenkaff Muscle Shoals, in denen Aretha Franklin, Solomon Burke, Percy Sledge, Wilson Pickett Geschichte schrieben mit Songs wie „Mustang Sally“, „I Never Loved A Man The Way I Love You“ oder der sensationellen Soul-Variante von „Hey Jude“. Legendär: Der funky Sound der Swampers, Hausband der FAME-Studios, die 1969 gleich nebenan ein eigenes Studio eröffneten, das Muscle Shoals Sound Studio. Auch die Stones nahmen hier, im Nirgendwo von Alabama, „Wild Horses“ und „Brown Sugar“ auf. Beste Szene des Films, als Paul Simon 1973 verkündet, er wolle die „hot black cats“ der Hausband für seinen Song „Kodachrome“ auf There Goes Rhymin’ Simon verpflichten. „That ain’t gonna happen“, so die Antwort. „Those black cats are mighty white.“ Im tief zerrissenen Alabama der spätfünfziger, der sechziger und der frühen siebziger Jahre bestand die Hausband der schwärzesten Soullabels der Musikgeschichte, Stax ausgenommen, aus „freundlichen, weißen Milchbubis“, wie Aretha Franklin es charmant bei ihrer letzten Filmaufnahme formulierte … So, und nun, gerade veröffentlicht: Muscle Shoals. Small Town Big Sound, eines dieser Compilationalben, bei denen Künstler aus dem Jetzt Songs aus dem Gestern interpretieren. Der Professor rät: kaufen! Schon wegen drei Songs: „I’d Rather Go Blind“, 1968 von Etta James aufgenommen, hier von Countrystimme Grace Potter manisch-melancholisch, mit weinendem Backgroundchor und tieftrauriger Basslinie interpretiert. „Gotta Serve Somebody“, von Bob Dylan 1979 eingespielter Südstaaten-Soulsong, hier unter anderem von Willie Nelson in einer zehnminütigen Verneigung gewürdigt. Und „Come And Go Blues“ von der Allman Brothers Band (Duane Allman war einst Mitglied der Swampers. „Come And Go Blues“ wurde seinerzeit anlässlich seines frühen Todes eingespielt), hier von der unvergleichlichen Alison Krauss mit neuem Leben erfüllt. Warum man aber Steven Tyler von Aerosmith „Brown Sugar“ brüllen lässt, den harmlosen Aloe Blacc am Staples-Singers-Klassiker „I’ll Take You There“ scheitern und Brently Stephen Smith mit Hardrock-Attitüde „Mustang Sally“ plattwalzen lässt … Well, I don’t know.
Lee Fields – It Rains Love

It Rains Love
Label: Big Crown Records
Format: CD, LP, DL 16/44,1
Ich habe Euch eingangs das Lied von Ingwer und Lindenblüten gesungen, verehrte Highend-Gospelgemeinde, und eins muss hier jetzt noch ergänzt werden im Medizinschränkchen von Prof. P.: Lee Fields. Ayurveda für die Ohren, Freunde, Balsam für verklebte Synapsen. Tatsächlich lauschte ich dem neuen Werk dieses grandiosen, leider oder vielleicht gottseidank nie so richtig berühmten Soulmans, als ich überm Kochtopf mit heißen Essenzen hing, Handtuch überm Kopf und Kräuterdünste im Gesicht. Benebelt vom Salbei, berauscht vom Soul, oder war’s umgekehrt? Tränen des Glücks tropften von der Nasenspitze, Ihr müsst das mal versuchen, Leute, jede Pore Eures Daseins möge sich öffnen und den Soul, den Gospel, den Funk und den Blues des Mr. Fields aufnehmen und durch die Seele wehen lassen wie eine sanfte Sommerbrise am Ufer des Hudson Rivers auf der Seite New Jerseys, hier, wo Lee Fields lebt und sich nur zum Besingen einer neuen Platte nach Downtown Americana begibt. 68 Jahre alt ist der Mann, im besten Soulshouter-Alter, und unter Vertrag bei Big Crown Records, jenem Label, das Daptone-Mitstreiter Leon Michels begründet hat für genau diesen Zweck: Den Soul zu bewahren und halb vergessenen Granden wie Fields die Bühne zu bieten, die sie verdient haben. It Rains Love unterscheidet sich nicht groß vom Vorgänger Special Night auf Big Crown oder all den anderen Fields-Platten auf Labels aus dem Daptone-Dunstkreis wie Truth & Soul und Desco – und das ist gut so. Fields stürzt sich in wunderbar retrowarmen Songs wie „Wake Up“, „Love Prisoner“ oder „God Is Real“ kopfüber in tiefste Schluchten des Soul, Funk und Blues, er schreit, er bettelt, er säuselt und er betet. Lord have mercy.
Band of Rascals – Tempest

Tempest
Label: Warehouse Recordings
Format: CD
Als Mr. George Vancouver am 10. Mai 1798 sein Haupte zum letzten Mal darniederlegte und in Richmond upon Thames in der englischen Grafschaft Surrey aus dieser Welt schied, konnte niemand ahnen, wie auch, dass sein Name 221 Jahre später in einer Musik-Publikation mit Namen FIDELITY auftauchen würde. Das ficht nun vielleicht seltsam an, denn FIDELITY ist ja keine Fachpublikation der Royal Canadian Geografical Society und auch kein Kompendium der berühmtesten Offiziere der britischen Royal Navy. Aber passt auf, der Professor setzt nun zu einem interdisziplinären Spagat von fantastischer Spannweite an. In wenigen Worten werden wir nun von Mr. Vancouvers größten Verdiensten, der Erforschung der nordamerikanischen Westküste über Kanada bis hinauf nach Alaska, direkt zur Betrachtung der erst zweiten EP der Band of Rascals kommen. Denn dieses Quartett begründete sich auf Vancouver Island, das, natürlich, nach George Vancouver benannt wurde, der dort mit den Spaniern über die Aufteilung des Landes verhandelte, das, so sollte man hier auch erwähnen, traditionell weder den Briten noch den Spaniern gehörte. Nun, ein Thema für sich. Jedenfalls ist Vancouver Island bis heute so was von ab vom Schuss, und wer hier in der kanadischen Provinz British Columbia rote Karohemden trägt, ist zumeist kein Hipster, sondern tatsächlich Holzfäller. Oder eben Mitglied bei The Band Of Rascals, die den nördlichsten Southern Rock der Hemisphäre spielen, greasy Gitarren, treibendes Trommelwerk, Grunge-Gesang mit Soulinfusion (Seattle: 200 Kilometer südlich) und Metal-Touch. Letzterer ist Produzent Eric Reiz zu verdanken, der schon die kanadischen Wumms-Vertreter Monster Truck und Billy Talent begleitete. Anspieltipps auf Tempest: „Holler“ (Bombast-Südstaaten-Rock from way up north), „Seas Coming Down“ (Gitarren im Duett mit genialem Post-Nirvana-Gesang) und „Reaction“ (Pophymnischer Stoner-Rock mit Soulgrundierung und Bluesfinish).
John Butler Trio – Home

Home
Label: Caroline
Format: CD, LP, DL 24/44,1
Achtung, Opa P. erzählt von früher: John Butler sah ich vor knapp 20 Jahren das erste Mal, da war der Gute gerade dem Dasein als Straßenmusiker in Perth und Umgebung entwachsen. Volles Haus am northgerman Hauptbahnhof, Schweiß & Tanz, der Boden klebrig von Glückshormonen: Doom-Blues-Dröhnung made in Down Under, schier endlose Gitarrensoli, umstampft von Bass und Drums – ein Ultimate-Fighting-Kampf, interpretiert von einem Bluesrocktrio. Vor wenigen Wochen wieder live: Riesenarena, Butler allein mit zwei Dutzend Gitarren, Drummer war erkrankt. Schicksal, kein Vorwurf. Aber auch dies: Der Professor verließ vorzeitig den Schauplatz, Intimität im Großveranstaltungshallenrahmen samt tausender hochgereckter Handys – not my cup of tea, wie man in Western Australia sagt. Daher: Dezent enttäuschter FIDELITY-Vorkoster, der vorbehaltsbeladen und hyperkritisch an das neue und siebte Studioalbum des John Butler Trios herangeht. Muss mich aber loben: Konnte mich distanzieren von der eigenen Erlebniswelt. Solides, teils sehr gutes Werk. Mehr Elektrobeats als gewohnt, Synthesizersounds als modernistische Verstärkung des alten Butler-Trio-Beats: Yeah, mates. Anspieltipps: „Just Call“ (Radionummer, dennoch starker Song, Melodienminiatur, die sich zum Pophymnenfolk erhebt), „Miss Your Love“ (gehaltvolle Folk-Grunge-Ballade) und „We Want More“ (treibender E-Blues mit vertrautem Butler-Charme). PS: Der Professor wühlt ja zu jedem Werk eine halbe Ewigkeit in Daten und Fakten und fragt sich daher: Muss ein weltbekannter Gitarrist seine Tochter unbedingt Banjo nennen?
Bonerama – Hot Like Fire

Hot Like Fire
Label: Basin Street Records
Format: CD, CD, DL 24/96
Stammleser meiner musikphilosophischen Miniaturmosaiken wissen: Vor vielen Monden weilte good ol’ Prof. P. eine Dreiviertelewigkeit in der verwunschenen Sumpfmoskitoworld deep down south, trank Tabasco aus Gallonen-Buddeln und bedampfte sein Bewusstsein mit Blues, Funk und Zydeco. Aus alter Leidenschaft schon schaue ich bis heute immer mit einem Ohr nach N’Awlins und verkünde dann in diesem Analog-Pamphlet, was sich so tut an den Ufern des Mississippi. Was haltet Ihr also davon? Drei Posaunen plus Bass, Drums und Gitarre. Bonerama blasen seit 20 Jahren ins Blech, dabei kommt ein Hardrock-Funk vorne heraus, Freunde, Freunde … Das aktuelle Album Hot Like Fire ist zwar schon seit einem Jahr draußen, doch wurde es via Retro-Mayflower über den großen Teich in des Professors Briefkasten verschifft. Bonerama, Wegbereiter für prominentere Posaunen-Künstler aus New Orleans wie Trombone Shorty oder Big Sam’s Funky Nation, gegründet von ehemaligen Mitgliedern der Bigband von Harry Connick Jr., haben sich einst mit Coverversionen von Black Sabbath und Jimi Hendrix die nötige Aufmerksamkeit erspielt, grundiert allerdings immer mit schönem Meters-Funk. Das neue Werk: Brass-Rock für Fortgeschrittene. Hört hier mal rein: „Bad Dog“ (Hardrockfunk, der ein Bayou trockenlegen kann), „Mr. Okra“ (Funk-Gumbo mit allem, was dazugehört) und „Paranoid Android“ (knapp siebenminütige Posaunenurgewalt, die über den bekannten Radiohead-Song hinwegwütet wie ein Hurrikan). PS: Wenn die Band nicht durch Louisiana tourt, besucht sie Highschools, um den Kindern die Kunst des Blechblasens beizubringen – JeKi-Unterricht, made in New Orleans. Gute Leute.
Gecko Turner – Soniquete. The Sensational Sound Of Gecko Turner

Soniquete. The Sensational Sound Of Gecko Turner
Label: Lovemonk
Format: CD, DL 16/44,1
Ja, Fernando Gabriel Echave Pelaez sagte mir bis vor kurzem nichts, das gebe ich gerne zu. Auch unter seinem Bühnennamen Gecko Turner (www verrät: Gecko nannte ihn seine Mutter, und er schätzt Blueslegende Big Joe Turner …) war er dem Professor bis dato nicht bekannt, und das ist schon eine mittelschwere Schande, auch das muss man selbstkritisch vermelden, spielt der in Spanien geborene Sound-Torero doch einen so heißen Paella-Funk, dass man in Villarriba und Villabajo gar nicht mehr auf die Idee kommen sollte, die Pfannen sauberzuschrubben – verzeiht den Ausflug ins Werbespotspanien der frühen neunziger Jahre. Zum Glück hat Gecko nun eine Best-of-Platte veröffentlicht aus knapp 20 Jahren wilder Karriere. Malditamente bien, amigos! Zu Deutsch (inkl. sinnloser Alliteration): Verdammt gut, Flamingos! Brasilianischer Reggae funkfusioniert mit Prince-Pop, Salsa-Bongos verschmelzen mit Mini-Moog-Wa-Wa zum einzigartigen Tausend-Volt-Folk, James Brown tanzt mit Bob Dylan Bossa Nova … Anspieltipps: „45.000$ (Guapa Paea)“ (Sambablues in feiner New-Orleans-Rhythmik), „Cortando Bajito“ (bisschen Isley Brothers, bisschen Meters-Funk, bisschen Jamiroquai – let’s dance, folks) und „Monosabio Blues“ (minimalistisches Arrangement, hier ein Pling, dort ein Klingeling, und trotzdem brennt die Seele).
Rad Orchestra – Rad Orchestra

Rad Orchestra
Label: Labelship
Format: CD, DL 16/44,1
Ein Konzert in einer kleinen Hinterhof-Tischlerei: Ein Sohn der Stadt kehrt zurück, vor Jahrzehnten auf der letzten Schaumkrone der Neuen Deutschen Welle vom Tor zur Welt aus gen Großbritannien gesurft und in Donlon, sorry, London, gestrandet. Max André Rademacher, Freund großer Safarihüte, früher Gitarrist bei Joachim Witt, mal in New Orleans tatsächlich ein Album von Soulpate Allen Toussaint produziert bekommen, irgendwie und irgendwas mit Robert Palmer sowie Sly & Robbie gemacht, heute Leiter des selbstgebastelten Rad Orchestra, angetreten zur charmanten Dekonstruktion von Jazz, Funk und Afrobeat zwecks Neukreation eines seltsamen Neo-Folks. Zwischen Tischen und Stühlen also vereinen sich Geige, Bratsche, Elektrobass und E-Gitarre samt Drums und Piano zu einer manischen Freak-Funk-Melange, nicht schlecht, sagt der Professor. Und empfiehlt deswegen das eigennamentlich betitelte Album des Rad Orchestra. Anspieltipps: „Ayonda“ (Soul aus der Sahara? Aus Soho? Fürs Sofa? Für den Selbstfindungs-Workshop im Wendland? Frühe Jethro Tull treffen späten Peter Gabriel trifft mittelalterliche Streicher-Kakophonie), „Excuse Me While I Grin“ (spartanischer Geigen-Bratschen-Funk mit dezenter Afrobeat-Grundierung und einer Ahnung Rhythmik-Verschachtelung à la Talking Heads) sowie das kompakt-knackige „Spinweed“ (pophymnischer Postmoderne-Funk für den nächsten Esoterik-Gangbang). Thanks for listening.


