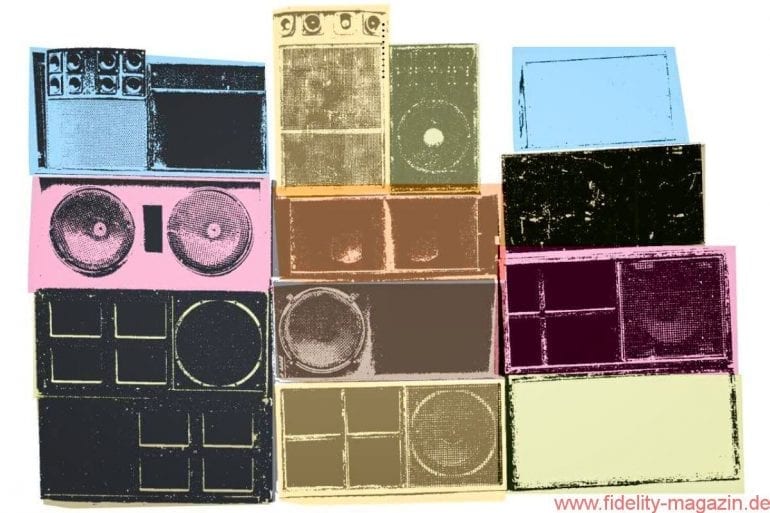Musikgeschmack, oder warum bewusstes Musikhören wichtig ist
Wer seinen Musikgeschmack nicht pflegt‚ verliert ihn. Und mit ihm möglicherweise eine wichtige Dimension der eigenen Persönlichkeit.
Illustration: Florian Schäfer
Was die Entwicklung des persönlichen Musikgeschmacks angeht, sind sich die meisten Soziologen und Psychologen einig. Im Kindes-alter werden Grundlagen unserer musikalischen Orientierung gelegt. In der Jugend steigt Musik zum Mittel der pubertären Selbstfindung auf, zum Identitätsmuster. Mit 25 Jahren ist der Musikgeschmack ausgebildet. Von da an, so glaubt die Wissenschaft, existiere bei jedem Menschen eine „stabile Präferenz“ für eine bestimmte Musikart oder Musikrichtung, wobei gewisse Abwandlungen des Geschmacks im Lauf der Jahr- zehnte nicht auszuschließen seien. Diese Darstellung des erwachsenen Musikgeschmacks halte ich für sehr beschönigend. Ich würde den Sachverhalt eher so formulieren: Die Mehrheit der 25-Jährigen hört einfach auf, der Musik Bedeutung in ihrem Leben einzuräumen. Neben Beruf, Ehe, Familie, Hobbys, Reisen usw. spielt die bewusste Wahl von Musik schlichtweg keine Rolle mehr. Das Verhältnis zu dem, was man in der eigenen Jugend gehört hat, verkümmert im Erwachsenenalter zu bloßer Sentimentalität. Neue Begegnungen mit Musik erfolgen nicht mehr aktiv und gewollt, sondern passiv und zufällig – durch Film, Fernsehen oder Radio, durch Empfehlungen von Kollegen, durch die musikalischen Interessen und Aktivitäten der eigenen Kinder usw.
Kurz gesagt: Der durchschnittliche Erwachsene ist in der Regel überhaupt kein bewusster Musik¬hörer. Er ist vielmehr ein willenloses Opfer belie¬biger und wechselnder Beschallung. Weder pflegt und verfeinert er seine ehemaligen Vorlieben im Musikalischen – noch formuliert und realisiert er so etwas wie einen erwachsenen Geschmack. Mal gefällt ihm der Sound einer jungen Rockband, weil er sie auf einer einsamen Autofahrt im Radio gehört hat, dann verfällt er einer Popsängerin, weil sie sich in einem Video so verführerisch bewegen konnte, dann wieder spricht ihn eine Mozartsonate enorm an, weil seine Tochter sie auf der Geige fiedelt. Für eine aktive musikalische Orientierung fehlen ihm Zeit und Geduld. Sein Musikgeschmack verödet. Sein Hörverhalten verwahrlost. Sein musikalisches Urteilsvermögen verkümmert.
Wie anders war das im Alter von 14, 15, 16 Jahren! Alle Gleichaltrigen waren damals genauso verrückt nach Musik wie ich – die Mitschüler, die Freunde im Jugendclub, die Nachbarskinder. Unser Thema Nummer eins waren die Rockbands der Stunde. Wenn wir uns trafen, war es das Wichtigste, gemeinsam Musik zu hören und darüber zu quat¬schen. Jeder erforschte die neueste Musik im Radio, jeder kaufte sich neue Platten, manche jagten nach seltenen Schätzen, wir liehen sie untereinander aus, machten Kassettenkopien, bewerteten gegenseitig die Stücke. Ich weiß noch, dass ich stundenlang die Songtexte von den Covers der geliehenen Platten ab¬tippte. Der eine Freund mochte besonders deutsche Bands, der andere 20-Minuten-Stücke, der dritte Keyboards, aber es gab einen großen Konsens: Musik bedeutete etwas. Und nichts, aber auch gar nichts wies damals darauf hin, dass Musik in meinem Le¬ben einmal eine andere, eine wichtigere Rolle spielen würde als bei den anderen.
Heute treffe ich Gleichaltrige, die überhaupt keine Lebensgeschichte als Musikhörer vorweisen können. Erstaunt erfahren sie von mir, dass das, was sie als Jugendliche gehört haben, in dieser oder jener Form bis heute fortbestanden oder sich weiterent¬wickelt hat. Meistens reagieren sie auf diese Entde¬ckung mit hilfloser, dankbarer Sentimentalität. Sie hatten einfach nichts davon mitbekommen. Dabei kaufen sie sogar hin und wieder eine CD oder gehen in ein Konzert – meist auf Anregung von Bekannten, die aus musikfernen Gründen irgendeine Nostalgie pflegen. Kurzum: Meine Gleichaltrigen bemühen sich um Musik so wenig, wie ich mich um die Ergebnisse der National Hockey League schere. „Stabile Präfe¬renz“? Wohl eher: kontinuierliches Desinteresse.
Aber ist das wichtig? Ja, denn Musik ist wichtig. Mit 14, 15, 16 Jahren wussten wir alle noch, dass Musik einen Teil unserer Persönlichkeit, unseres Le¬bensgefühls, unserer Weltwahrnehmung ausmacht. Wir spürten oder ahnten damals, dass Musik eine psychotrope „Substanz“ ist, die uns als Erweiterung unseres Ichs dient – stimulierend, tröstend, dämp¬fend, vertiefend, in jedem Fall: beglückend und berei-chernd. Und dass die Art, wie wir individuell, gezielt und bewusst mit dieser „Droge“ umgehen, unsere Menschwerdung bezeugt, unsere Reife beweist, un¬seren Charakter beschreibt, unseren Intellekt spiegelt und formt. Wer auf einen aktiven Musikgeschmack verzichtet, macht einen Teil seiner Persönlichkeit zum Spielball zufälliger musikalischer Einflüsse. Wer Musik aus dem Zentrum seines Lebens verbannt, beraubt sich vieler Möglichkeiten seiner emotionalen und geistigen Existenz. Sein Leben verarmt.
Sorgen mache ich mir um diejenigen, die heute 14, 15, 16 sind. Die digitale Allverfügbarkeit von Mu¬sik hat die Spezies des Musikfans schon fast völlig ausgerottet. Was nahmen wir früher für Mühen auf uns, um seltene Platten aufzutreiben! Von Bands, die ich mochte, wollte ich jeden Ton haben und jedes Nebenprojekt kennen! Wir hörten ein Album, so wie man ein Buch liest – oder durch ein Museum schlen¬dert. Heute scheint das anders zu sein. Die Jungen sind nicht mehr Fans einer Band oder eines Albums. Sie setzen sich mit Musik nicht mehr auseinander. Sie „liken“ nur einfach dieses Stück oder jenes Stück. Sie streamen und downloaden beliebig, tauschen und teilen nach Laune. Für sie ist Musik ein jederzeit abrufbarer „Kick“, für viele nur das tönende Gleitmit¬tel zur Ecstasy-Pille. Schon als Jugendlichen entge¬hen ihnen viele Möglichkeiten ihrer emotionalen und geistigen Entwicklung. Vielleicht fehlt ihnen sogar eine Dimension ihrer Persönlichkeit. Aber wer weiß? Möglicherweise entwickeln sie ja eines Tages als Erwachsene dann – Musikgeschmack.